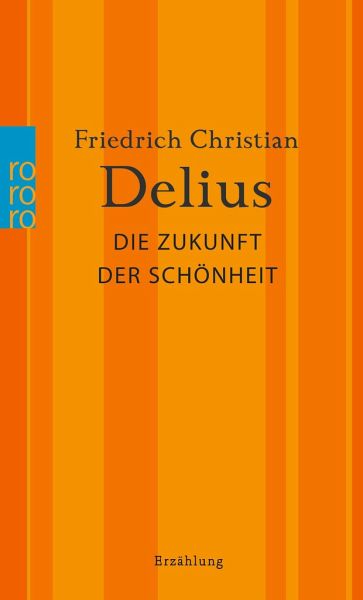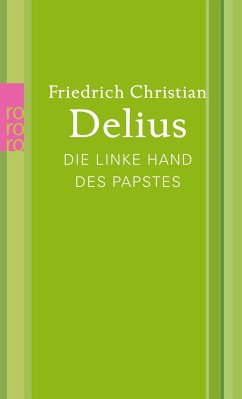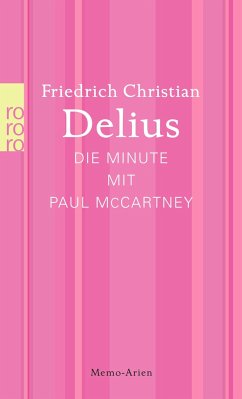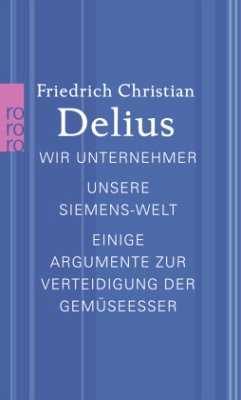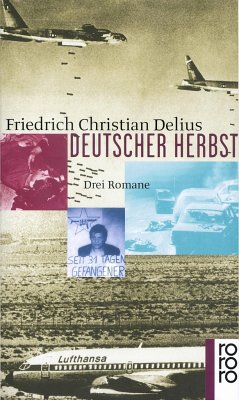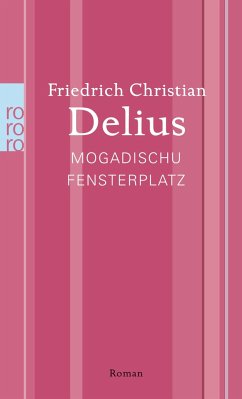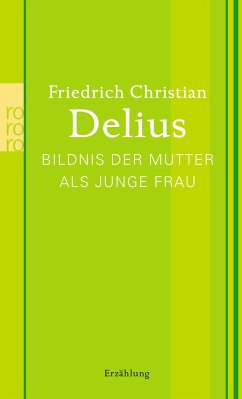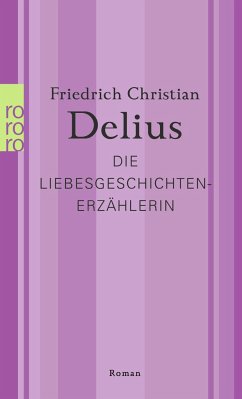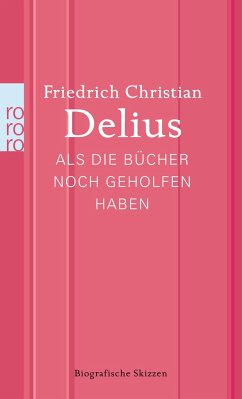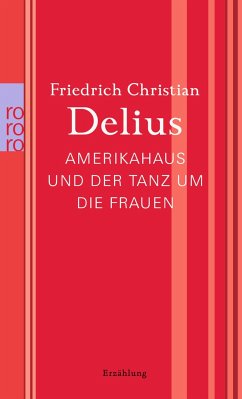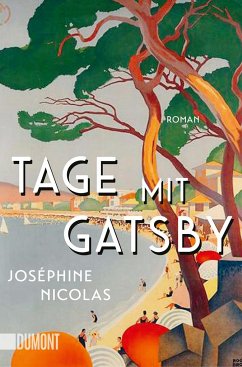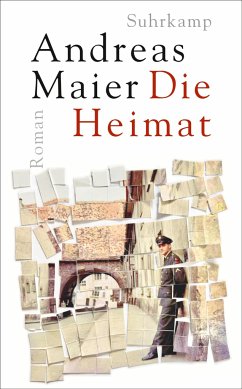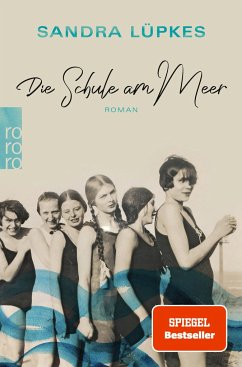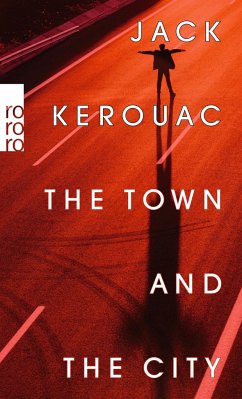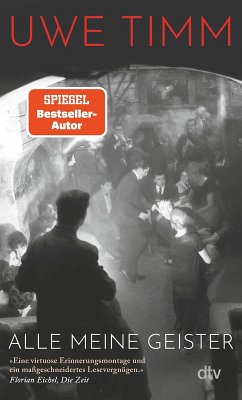Friedrich Christian Delius
Broschiertes Buch
Die Zukunft der Schönheit
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





In dieser autobiografischen Erzählung des vielfach ausgezeichneten Autors wird der Aufbruchsgeist einer ganzen Epoche beschworen. Sie führt dem Leser die Kraft der Musik vor Augen.Am 1. Mai 1966 gerät ein junger Deutscher aus der hessischen Provinz in einen New Yorker Jazzclub, es spielt der Saxofonist Albert Ayler. Was der Musiker mit seiner Band auf die Bühne bringt, ist die unerhörteste Musik jener Zeit: wildester Free Jazz. Befremdet, beschwingt und gebannt von Aylers Improvisationsrausch, begreift der junge Mann in einem hellsichtigen Assoziationstaumel die revolutionäre Energie, di...
In dieser autobiografischen Erzählung des vielfach ausgezeichneten Autors wird der Aufbruchsgeist einer ganzen Epoche beschworen. Sie führt dem Leser die Kraft der Musik vor Augen.
Am 1. Mai 1966 gerät ein junger Deutscher aus der hessischen Provinz in einen New Yorker Jazzclub, es spielt der Saxofonist Albert Ayler. Was der Musiker mit seiner Band auf die Bühne bringt, ist die unerhörteste Musik jener Zeit: wildester Free Jazz. Befremdet, beschwingt und gebannt von Aylers Improvisationsrausch, begreift der junge Mann in einem hellsichtigen Assoziationstaumel die revolutionäre Energie, die in Wachheit und Wut steckt. Die Musik lässt ihn körperlich fühlen, wie Zerstören und Zersetzen der Beginn alles Schönen sein kann und die Kunst das Rettende wird.
Am 1. Mai 1966 gerät ein junger Deutscher aus der hessischen Provinz in einen New Yorker Jazzclub, es spielt der Saxofonist Albert Ayler. Was der Musiker mit seiner Band auf die Bühne bringt, ist die unerhörteste Musik jener Zeit: wildester Free Jazz. Befremdet, beschwingt und gebannt von Aylers Improvisationsrausch, begreift der junge Mann in einem hellsichtigen Assoziationstaumel die revolutionäre Energie, die in Wachheit und Wut steckt. Die Musik lässt ihn körperlich fühlen, wie Zerstören und Zersetzen der Beginn alles Schönen sein kann und die Kunst das Rettende wird.
Friedrich Christian Delius, geboren 1943 in Rom, gestorben 2022 in Berlin, wuchs in Hessen auf und lebte seit 1963 in Berlin. Zuletzt erschienen der Roman 'Wenn die Chinesen Rügen kaufen, dann denkt an mich' (2019) und der Erzählungsband 'Die sieben Sprachen des Schweigens' (2021). Delius wurde unter anderem mit dem Fontane-Preis, dem Joseph-Breitbach-Preis und dem Georg-Büchner-Preis geehrt. Seine Werkausgabe im Rowohlt Taschenbuch Verlag umfasst derzeit einundzwanzig Bände.
Produktdetails
- Delius: Werkausgabe in Einzelbänden
- Verlag: Rowohlt TB.
- Artikelnr. des Verlages: 95709021
- 1. Auflage, Neuausgabe
- Seitenzahl: 91
- Erscheinungstermin: 31. Januar 2023
- Deutsch
- Abmessung: 188mm x 113mm x 9mm
- Gewicht: 92g
- ISBN-13: 9783499010422
- ISBN-10: 3499010429
- Artikelnr.: 63745277
Herstellerkennzeichnung
Rowohlt Taschenbuch
Kirchenallee 19
20099 Hamburg
produktsicherheit@rowohlt.de
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Andreas Kilb versteht: Das Buch ist keine Novelle, sondern eine "klassische Jazznummer in Prosa". Was F.C. Delius hier in einer gekonnten assoziativen Vermengung von Autobiografie und Historie skizziert, die eigene Teilnahme bei der Princeton-Sitzung der Gruppe 47, das erste Free-Jazz-Erlebnis in New York, Kennedy, Vietnam, oberhessische Schulzeit, der Vater, die Altnazis, enthält "Höhepunkte der deutschen Gegenwartsliteratur", so der hingerissene Rezensent. Ob autobiografisch oder zeitgeschichtlich genau oder nicht, ist da ganz gleichgültig, findet er. Der dritte Teil der Delius'schen literarischen Selbsterforschung: für Kilb unbedingt lesenswert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Der Augenblick in Slug's Saloon gehört zu den Höhepunkten der deutschen Gegenwartsliteratur, zu jenen Prosastücken, bei denen es egal ist, ob sie biographisch und zeitgeschichtlich beglaubigt sind oder nur große Wortkunst. FAZ.NET
Bekenntnisse eines Sprachprotestanten
Er verliert nie die Lust am eigenen Ich: Mit "Die Zukunft der Schönheit" setzt Friedrich Christian Delius seine literarische Selbsterforschung fort.
Von Andreas Kilb
Ein junger Mann, Nachwuchsdichter, Literaturstudent, nichtlesender Teilnehmer an der berühmten Princeton-Tagung der Gruppe 47, geht mit zwei Freunden in eine Jazzkneipe in New York. Es ist der Abend des 1. Mai 1966, der letzte Abend vor dem Rückflug nach Berlin, die Band von Albert Ayler spielt in Slug's Saloon in der Third Street, und der Besucher hört zum ersten Mal eine Musik, die ihn bis an die Grenzen seiner Leidensfähigkeit strapaziert: "Das musst du jetzt aushalten, das wirst du aushalten, sagte ich
Er verliert nie die Lust am eigenen Ich: Mit "Die Zukunft der Schönheit" setzt Friedrich Christian Delius seine literarische Selbsterforschung fort.
Von Andreas Kilb
Ein junger Mann, Nachwuchsdichter, Literaturstudent, nichtlesender Teilnehmer an der berühmten Princeton-Tagung der Gruppe 47, geht mit zwei Freunden in eine Jazzkneipe in New York. Es ist der Abend des 1. Mai 1966, der letzte Abend vor dem Rückflug nach Berlin, die Band von Albert Ayler spielt in Slug's Saloon in der Third Street, und der Besucher hört zum ersten Mal eine Musik, die ihn bis an die Grenzen seiner Leidensfähigkeit strapaziert: "Das musst du jetzt aushalten, das wirst du aushalten, sagte ich
Mehr anzeigen
mir, als wir uns gesetzt hatten. Fünf Musiker auf der schmalen Bühne, einer mit Saxophon, einer mit Trompete, einer am Schlagzeug, ein Bassist und ein Geiger, fünf Männer prügelten mit ihren Instrumenten auf meine Hörnerven ein, und ich dachte nur, lehn dich zurück und hör einfach zu oder hör weg -".
So beginnt die Geschichte. Es geht um Musik, um den Free Jazz der sechziger Jahre, und um das, was sie im Zuhörer aufruft, Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Abwehr und jubelnde Zustimmung. Vor allem aber geht es um ihn selbst, um den jungen Mann aus Berlin, der mit einem Bier in der Hand im Dunkeln sitzt, eingehüllt ins "Getröte, Gezirpe, Gehämmer, Gejaule" der Töne, um den Jüngling, der Friedrich Christian Delius vor zweiundfünfzig Jahren war. Wäre "Die Zukunft der Schönheit" ein Film, dann gäbe Albert Aylers Jazzmusik den Soundtrack dazu, besonders jene brutalistische Version des Gospel-Klassikers "When the Saints Go Marching in", die zwischen New York und dem oberhessischen Städtchen Korbach eine unsichtbare Brücke schlägt, auf der die Phantasie des Jünglings durch die Zeiten tanzt. Der Schauplatz der Handlung aber läge weder hier noch dort, sondern allein im Kopf des Erzählers. Im Kopf dessen, der die Erzählung schreibt, und zugleich in dem des Dreiundzwanzigjährigen, der sie vor einem halben Jahrhundert erlebt hat; in einem doppelten imaginären Raum. Für einen Film wäre das zu viel der Abstraktion. Für "Die Zukunft der Schönheit" ist es gerade genug.
Zurück in die Third Street. Die Band spielt, der Erzähler lauscht, und dabei fällt ihm als Erstes jene Schriftstellertagung ein, auf der ihm ein Auftritt - es wäre sein dritter gewesen - auf dem "elektrischen Stuhl", dem Vorlesesessel der Gruppe 47, glücklich erspart geblieben ist. Dafür hat ein Jüngling aus Österreich seine Chance genutzt, der nicht nur die Tagungsteilnehmer beschimpft, sondern sich auch vor laufenden Fernsehkameras auf dem Empire State Building "als neuer Kafka ausgerufen" hat. Es ist Peter Handke, und mit seiner Erwähnung verschränkt sich die autobiographische Perspektive endgültig mit der zeitgeschichtlichen. Denn mit Handkes berühmter Pöbelei in Princeton beginnt nicht nur die Pop-Phase der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur, es endet auch die Geniezeit des F. C. Delius, und es beginnen die Mühen der Ebene.
Zu Hause in Berlin wartet ein Konvolut auf ihn, aus dem das Enthüllungsbuch "Wir Unternehmer" erwachsen wird, die erste von mehreren Abrechnungen mit den Mythen des deutschen Wirtschaftswunders und der Anfang einer Prozesslawine, die den Autor bis in die späten siebziger Jahre verfolgt. Erst 1981 kommt der erste Roman, und erst zehn Jahre darauf, mit den "Birnen von Ribbeck", die allgemeine Anerkennung, der literarische Ruhm. Davon weiß der junge Delius in der Jazzbar noch nichts. Aber der alte weiß es, und er schreibt es der Erzählung ein.
Bevor sein durch Albert Aylers Saxophon und ein gerade erstelltes, überaus schmeichelhaftes Horoskop befeuerter Aufbruch in die Zukunft beginnt, schaut der Held zurück: auf seine oberhessische Schulzeit und das Wurzelgeflecht von Altnazis, das sich unter der gutbürgerlichen Oberfläche Korbachs verbarg, auf die ersten Erfolge mit reimloser Lyrik und die frühen Studienjahre in Berlin, auf die Rede Kennedys an der Freien Universität und den Vortrag Pasolinis in der Kongresshalle. Vor allem aber auf die letzte Auseinandersetzung mit dem todkranken Vater, der seinen Sohn in hilflosem Zorn mit einem Kissen bewirft, weil Delius junior die Feier zu seinem siebzehnten Geburtstag bis in die Nachtstunden ausgedehnt hat.
Es ist derselbe Kriegsheimkehrer-Vater und evangelische Gemeindepfarrer, der schon in "Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde" und in "Amerikahaus und der Tanz um die Frauen" eine tragende Rolle spielte und nun, im Schlussstück der Trilogie, sein Requiem bekommt. Sein Part ist kläglich. Seine Züchtigung verpufft. Aber dann, mitten im FreeJazz-Gewitter, wird dem jungen Dichter auf einmal klar, wem er sein Sprachempfinden vor allem zu verdanken hat: "am meisten doch dem Prediger, der mich mit kräftigem Lutherdeutsch, poetischen Psalmen und der Schlagkraft der Choräle geschult" und zugleich "das Gehör für Phrasen und Hohlheit geschärft hatte". Und so streift den Sohn "der Gedanke der Milde", der "Weichheit" gegenüber dem Toten.
Mag sein, dass die zögernde Abbitte, aus dem Abstand von fünfzig Jahren in den Kopf eines Jünglings gepflanzt, ein literarischer Kniff ist, eine Fiktion. Aber so, wie Delius diesen Moment in den assoziativen Fluss seiner Prosa einbettet, wie er das Vatermotiv anspielt, variiert und schließlich zu einem durchdringenden Akkord verdichtet, gehört der Augenblick in Slug's Saloon zu den Höhepunkten der deutschen Gegenwartsliteratur, zu jenen Prosastücken, bei denen es egal ist, ob sie biographisch und zeitgeschichtlich beglaubigt sind oder nur große Wortkunst. Das Gleiche gilt, von einigen allzu adjektivisch flottierenden und vom eigenen Formulierungsfuror berauschten Passagen abgesehen, für die ganze Erzählung.
Eines nämlich hat der medienscheue Spätentwickler und Sprachprotestant Delius mit seinem Antipoden Handke gemein: Er wird seiner selbst niemals müde, verliert nie die Lust am eigenen Ich. Und so handeln Delius' beste Bücher, allen voran das meisterliche "Bildnis der Mutter als junge Frau", nicht von historischen Ereignissen (wie die Trilogie zum "deutschen Herbst"), sondern von ihren Spiegelungen im Privaten, Biographischen, in der Welt der kleinen Leute und kleinen Dinge.
Nur dass Delius in seinen biographischen Nahaufnahmen immer die geschichtliche Totale mitbedenkt. Kennedys Ermordung, der Vietnamkrieg, die Auschwitzprozesse, die Studentenbewegung, der Autorenfilm, all das klingt in dieser kaum hundertseitigen Skizze an, ohne umständlich erklärt zu werden (dafür genügt in Zeiten von Wikipedia ein Mausklick). Und es hätte nicht der Gedankenstriche am Ende jedes Absätzes bedurft, damit wir begreifen, dass dies keine klassische Novelle ist, sondern eine Jazznummer in Prosa. Nur bei Albert Ayler, dem Genie der freien Töne, setzt die Geschichte einen Schlusspunkt: Vier Jahre nach dem Auftritt am 1. Mai springt er von der Fähre zur Freiheitsstatue in den Tod. "Die Zukunft der Schönheit" zündet auch für ihn eine Kerze an.
Friedrich Christian Delius: "Die Zukunft der Schönheit". Erzählung.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2018. 96 S., geb., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
So beginnt die Geschichte. Es geht um Musik, um den Free Jazz der sechziger Jahre, und um das, was sie im Zuhörer aufruft, Gedanken, Gefühle, Erinnerungen, Abwehr und jubelnde Zustimmung. Vor allem aber geht es um ihn selbst, um den jungen Mann aus Berlin, der mit einem Bier in der Hand im Dunkeln sitzt, eingehüllt ins "Getröte, Gezirpe, Gehämmer, Gejaule" der Töne, um den Jüngling, der Friedrich Christian Delius vor zweiundfünfzig Jahren war. Wäre "Die Zukunft der Schönheit" ein Film, dann gäbe Albert Aylers Jazzmusik den Soundtrack dazu, besonders jene brutalistische Version des Gospel-Klassikers "When the Saints Go Marching in", die zwischen New York und dem oberhessischen Städtchen Korbach eine unsichtbare Brücke schlägt, auf der die Phantasie des Jünglings durch die Zeiten tanzt. Der Schauplatz der Handlung aber läge weder hier noch dort, sondern allein im Kopf des Erzählers. Im Kopf dessen, der die Erzählung schreibt, und zugleich in dem des Dreiundzwanzigjährigen, der sie vor einem halben Jahrhundert erlebt hat; in einem doppelten imaginären Raum. Für einen Film wäre das zu viel der Abstraktion. Für "Die Zukunft der Schönheit" ist es gerade genug.
Zurück in die Third Street. Die Band spielt, der Erzähler lauscht, und dabei fällt ihm als Erstes jene Schriftstellertagung ein, auf der ihm ein Auftritt - es wäre sein dritter gewesen - auf dem "elektrischen Stuhl", dem Vorlesesessel der Gruppe 47, glücklich erspart geblieben ist. Dafür hat ein Jüngling aus Österreich seine Chance genutzt, der nicht nur die Tagungsteilnehmer beschimpft, sondern sich auch vor laufenden Fernsehkameras auf dem Empire State Building "als neuer Kafka ausgerufen" hat. Es ist Peter Handke, und mit seiner Erwähnung verschränkt sich die autobiographische Perspektive endgültig mit der zeitgeschichtlichen. Denn mit Handkes berühmter Pöbelei in Princeton beginnt nicht nur die Pop-Phase der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur, es endet auch die Geniezeit des F. C. Delius, und es beginnen die Mühen der Ebene.
Zu Hause in Berlin wartet ein Konvolut auf ihn, aus dem das Enthüllungsbuch "Wir Unternehmer" erwachsen wird, die erste von mehreren Abrechnungen mit den Mythen des deutschen Wirtschaftswunders und der Anfang einer Prozesslawine, die den Autor bis in die späten siebziger Jahre verfolgt. Erst 1981 kommt der erste Roman, und erst zehn Jahre darauf, mit den "Birnen von Ribbeck", die allgemeine Anerkennung, der literarische Ruhm. Davon weiß der junge Delius in der Jazzbar noch nichts. Aber der alte weiß es, und er schreibt es der Erzählung ein.
Bevor sein durch Albert Aylers Saxophon und ein gerade erstelltes, überaus schmeichelhaftes Horoskop befeuerter Aufbruch in die Zukunft beginnt, schaut der Held zurück: auf seine oberhessische Schulzeit und das Wurzelgeflecht von Altnazis, das sich unter der gutbürgerlichen Oberfläche Korbachs verbarg, auf die ersten Erfolge mit reimloser Lyrik und die frühen Studienjahre in Berlin, auf die Rede Kennedys an der Freien Universität und den Vortrag Pasolinis in der Kongresshalle. Vor allem aber auf die letzte Auseinandersetzung mit dem todkranken Vater, der seinen Sohn in hilflosem Zorn mit einem Kissen bewirft, weil Delius junior die Feier zu seinem siebzehnten Geburtstag bis in die Nachtstunden ausgedehnt hat.
Es ist derselbe Kriegsheimkehrer-Vater und evangelische Gemeindepfarrer, der schon in "Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde" und in "Amerikahaus und der Tanz um die Frauen" eine tragende Rolle spielte und nun, im Schlussstück der Trilogie, sein Requiem bekommt. Sein Part ist kläglich. Seine Züchtigung verpufft. Aber dann, mitten im FreeJazz-Gewitter, wird dem jungen Dichter auf einmal klar, wem er sein Sprachempfinden vor allem zu verdanken hat: "am meisten doch dem Prediger, der mich mit kräftigem Lutherdeutsch, poetischen Psalmen und der Schlagkraft der Choräle geschult" und zugleich "das Gehör für Phrasen und Hohlheit geschärft hatte". Und so streift den Sohn "der Gedanke der Milde", der "Weichheit" gegenüber dem Toten.
Mag sein, dass die zögernde Abbitte, aus dem Abstand von fünfzig Jahren in den Kopf eines Jünglings gepflanzt, ein literarischer Kniff ist, eine Fiktion. Aber so, wie Delius diesen Moment in den assoziativen Fluss seiner Prosa einbettet, wie er das Vatermotiv anspielt, variiert und schließlich zu einem durchdringenden Akkord verdichtet, gehört der Augenblick in Slug's Saloon zu den Höhepunkten der deutschen Gegenwartsliteratur, zu jenen Prosastücken, bei denen es egal ist, ob sie biographisch und zeitgeschichtlich beglaubigt sind oder nur große Wortkunst. Das Gleiche gilt, von einigen allzu adjektivisch flottierenden und vom eigenen Formulierungsfuror berauschten Passagen abgesehen, für die ganze Erzählung.
Eines nämlich hat der medienscheue Spätentwickler und Sprachprotestant Delius mit seinem Antipoden Handke gemein: Er wird seiner selbst niemals müde, verliert nie die Lust am eigenen Ich. Und so handeln Delius' beste Bücher, allen voran das meisterliche "Bildnis der Mutter als junge Frau", nicht von historischen Ereignissen (wie die Trilogie zum "deutschen Herbst"), sondern von ihren Spiegelungen im Privaten, Biographischen, in der Welt der kleinen Leute und kleinen Dinge.
Nur dass Delius in seinen biographischen Nahaufnahmen immer die geschichtliche Totale mitbedenkt. Kennedys Ermordung, der Vietnamkrieg, die Auschwitzprozesse, die Studentenbewegung, der Autorenfilm, all das klingt in dieser kaum hundertseitigen Skizze an, ohne umständlich erklärt zu werden (dafür genügt in Zeiten von Wikipedia ein Mausklick). Und es hätte nicht der Gedankenstriche am Ende jedes Absätzes bedurft, damit wir begreifen, dass dies keine klassische Novelle ist, sondern eine Jazznummer in Prosa. Nur bei Albert Ayler, dem Genie der freien Töne, setzt die Geschichte einen Schlusspunkt: Vier Jahre nach dem Auftritt am 1. Mai springt er von der Fähre zur Freiheitsstatue in den Tod. "Die Zukunft der Schönheit" zündet auch für ihn eine Kerze an.
Friedrich Christian Delius: "Die Zukunft der Schönheit". Erzählung.
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2018. 96 S., geb., 16,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Schließen
Gebundenes Buch
Nervend breit ausgewalzter Mist, der dennoch nur 90 Buchseiten für unverschämte 16 € füllt – und Selbstbespiegelung ohne jeden Nutzen für den Leser. Noch schlimmer wird es, wenn im Hörbuch Christian Brückner das Blabla durch seine Interpretation …
Mehr
Nervend breit ausgewalzter Mist, der dennoch nur 90 Buchseiten für unverschämte 16 € füllt – und Selbstbespiegelung ohne jeden Nutzen für den Leser. Noch schlimmer wird es, wenn im Hörbuch Christian Brückner das Blabla durch seine Interpretation bedeutungsschwanger auflädt.
Weniger
Antworten 1 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für