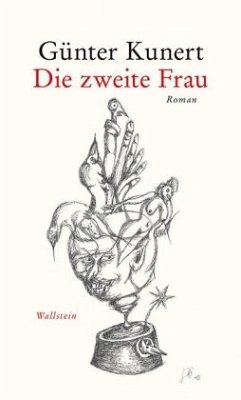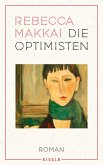Ein Roman, geschrieben vor 45 Jahren - in der DDR »absolut undruckbar«, wusste Kunert und versteckte ihn im Archiv. Nun wiedergefunden, wird er endlich veröffentlicht.In einer Truhe fand Günter Kunert unlängst ein Manuskript, das er vor fast fünfundvierzig Jahren geschrieben hat - einen Roman, so frech, brisant und »politisch unmöglich«, dass Kunert, der damals noch in der DDR lebte, ihn gar nicht erst einem Verlag vorlegte. »Absolut undruckbar«, wusste er und vergrub das Manuskript so tief in seinem Archiv, dass er selbst es vollkommen vergaß und erst jetzt durch Zufall wiederfand.Kunert ist berühmt für seine skeptischen Gedichte, die vor ökologischen Katastrophen und Fehlentwicklungen warnen, für seine Miniaturen und kurzen Prosatexte, Notate, Hörspiele, Filme; als Romanautor kennt man ihn eher nicht. Und hier ist nun ein Roman, funkelnd und frisch, geschrieben zur Hälfte des Lebens: Der männliche Protagonist sucht nach einem Geschenk zum vierzigsten Geburtstag seiner Frau; dieAuswahl in den Geschäften ist ebenso entmutigend wie seine Einfallslosigkeit, schließlich tauscht er Mark der DDR in Westgeld, um im Intershop einzukaufen, und macht dort unbedachte Bemerkungen. So nimmt eine Tragikomödie um Montaigne, Missverständnisse und Stasi-Tumbheit ihren Lauf.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Vor mehr als vierzig Jahren verfasste Günter Kunert, damals noch in der DDR lebend, das Manuskript zu "Die zweite Frau". Jetzt wird es endlich veröffentlicht.
Ich wurde früh zu einem Sympathisanten, Anhänger, Mitläufer, Interessenten, Freund und Süchtigen der Archäologie gemacht", verrät Günter Kunert in seinen 2018 unter dem Titel "Ohne Umkehr" veröffentlichten Aufzeichnungen aus den letzten Jahren. "Dadurch, dass ich als Kind die Zerstörung meiner Umwelt und das Verschwinden meiner Verwandten erleiden musste, suchte ich in allen Relikten und Rudimenten meiner Vergangenheit."
Der Autor als Archäologe gräbt selbstverständlich von Zeit zu Zeit auch seinen Keller um, und so entdeckte Kunert vor ein paar Jahren ein Romanmanuskript wieder, das er 1974/75 geschrieben hatte und dessen Protagonist ein Archäologe ist. Das Skript verschwand damals sofort in der Schublade, weil sein Autor in der DDR nicht die geringste Chance auf Veröffentlichung sah. Man muss nur die Eingangsszene lesen, einen Albtraum, in dem der Protagonist Barthold in London Walter Ulbricht begegnet, um diese Einschätzung zu teilen. Der erste Staatsratsvorsitzende war zwar damals schon geschasst und durch Erich Honecker abgelöst, aber als literarische Schreckens- oder Witzfigur nicht zugelassen.
Barthold, verheiratet mit Margarete Helene (in deren Namen sich Fausts Gretchen mit der schönen Helena vermählt), sucht ein Geschenk für deren vierzigsten Geburtstag. In der DDR ist das schon damals, anderthalb Jahrzehnte vor ihrem wirtschaftlichen Ruin, weniger eine Frage des Geldes als des nicht vorhandenen Angebots. Barthold aber muss auf jeden Fall etwas Besonderes finden, um seine Frau milde zu stimmen, hat diese doch einen Büstenhalter gefunden, der zweifelsfrei nicht ihr gehört: das Ganze beim Abreißen eines alten Schuppens, auch einer Form der Archäologie. Diese Form bringt später auch noch vergrabene Knochen ans Licht und eine alte Postkarte von einer gewissen Elfi, und aus beiden reimt sich Margarete Helene die Vorstellung zusammen, ihr Mann könne weit vor ihrer Zeit einen Mord begangen haben.
Dieser, wegen vegetativer Dystonie krankgeschrieben, tröstet sich über den Zustand seines Landes wie der Welt mit der Lektüre von Montaigne. Als ihm die rettende Möglichkeit eröffnet wird, an Westgeld zu kommen und in der magischen Welt des Intershops einkaufen zu können, unterhält er sich mit dem dort hinter ihm wartenden Mann und zitiert fleißig aus den "Essais".
Nicht der Einkauf im Intershop, nicht das Westgeld ist es, das die Staatssicherheit auf den Plan ruft, sondern Bartholds offensichtlicher Kontakt zu einem Ausländer, einem gewissen "Mohnteine". Barthold will erst laut lachen, aber "Besserwissen führt bestenfalls zu nichts, schlimmstenfalls zu negativen Auswirkungen. Der Andere führte aus, der Ausländer, wohl Franzose, wie?, habe keine positive Einstellung erkennen lassen, wie aus Bartholds Reden zu entnehmen sei, doch ginge es in der Hauptsache darum, dass er, Barthold, doch ganz genau wisse, dass jede Bekanntschaft mit Ausländern für ihn meldepflichtig sei." Barthold will dem Abgesandten der Stasi - "Sie können mich Müller nennen" - seinen Band Montaigne zeigen, der immer auf seinem Nachttisch liegt, aber seine Frau hat ihn am Tag zuvor weggeschmissen, eifersüchtig nicht nur auf die ominöse Elfi, sondern seit langem auch schon auf das Lieblingsbuch, ja den unverzichtbaren Lebensbegleiter ihres Mannes. Barthold kann sich nicht entlasten, und die Dinge nehmen ihren Lauf. Wie, das soll nicht verraten werden.
Kunerts Roman, sowohl aus der Perspektive Bartholds als auch aus der seiner Frau erzählt, ist eine derbe Komödie mit todernstem Hintergrund. Er verrät eine bei diesem Autor überraschende Lust am Erzählen und hat, im Gegensatz zu den Verhältnissen, die er schildert, keinen Grünspan angesetzt. Der Lust am Erzählen gesellt sich die an der Reflexion bei, vertreten hier durch Montaigne und vermittelt durch Barthold. Dass eben diese Lust an der Reflexion dem Helden zum Verhängnis wird, liegt an der Gegenseite. Bekanntlich war die Stasi so gut wie allwissend und doch zugleich stockdoof: eine überaus gefährliche Mischung.
Spannend ist nun die Frage, welchen Stellenwert die Arbeit an diesem Roman im Werk eines Autors hatte, der sich bewusst war, dass er diese Geschichte in der DDR niemals würde veröffentlichen können. Geschrieben Mitte der siebziger Jahre und ein gutes Jahr vor der Ausbürgerung Wolf Biermanns, gegen die Kunert dann als einer der ersten protestiert hat, hatte das Manuskript wohl vor allem die Funktion einer Selbstverständigung und Standortbestimmung. Kunert, der reisen durfte und schon damals mehr von der Welt gesehen hatte als die meisten seiner Mitbürger, hatte aus diesem Grund sicher einen schärferen Blick für die grotesken Verhältnisse im eigenen Land, das er dann konsequenterweise auch wenige Jahre danach verlassen hat. Wer als vierzehn-, fünfzehnjähriger sogenannter Halbjude im Nazireich überlebt und die Bombennächte von Berlin miterlebt hatte und danach den Umschlag der frühen sozialistischen Hoffnungen in deren vom Mangel gesteuerte Perversion, der war spätestens in der DDR der Mittsiebziger gegen alle Versuchungen gefeit, Weltgeschichte als Heilsgeschehen misszuverstehen, in welcher Form auch immer. Die Groteske, die Kunert damals für die Schublade schrieb - und später dann für den Keller, aus dem sie nun unverhofft aufgetaucht ist -, lässt sich durchaus als der erzählerische Befreiungsschlag lesen, der seinen Autor ein für alle Male von eventuell noch schwelenden Illusionen erlöste.
Seitdem, so können wir dem weiteren Werk des Lyrikers und Essayisten Günter Kunert, der heute neunzig Jahre alt wird, entnehmen, "ist mein Interesse am Fiktionalen erloschen. Die Realität hat alle Fantasie übertroffen und aus dem Feld geschlagen." So heißt es in "Ohne Umkehr", den Aufzeichnungen aus den letzten Jahren. Dennoch hält Kunert an der Schrift fest, möglichst Tag für Tag, "um sich schreibend bei Bewusstsein zu halten, um der allgemeinen Lethargie zu entgehen . . . Es gilt, das eigene Bewusstsein nicht in die billige Akzeptanz des Bestehenden absinken zu lassen." Mit Altersmilde hat das herzlich wenig zu tun. Man darf ihm deshalb wünschen, dass dieser Kampf gegen Bewusstseinstrübung und für skeptische Klarsicht, für die Montaigne gewiss der angemessene Ahne und Schirmherr ist, noch lange anhält. Uns als seinen Lesern käme das jedenfalls zugute.
JOCHEN SCHIMMANG
Günter Kunert: "Die zweite Frau". Roman.
Wallstein Verlag, Göttingen 2019. 204 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Dlf Kultur-Rezension
Die Geschichte hinter Günter Kunerts neuem alten Roman wirkt ausgedachter als der Roman selbst, findet Rezensentin Elke Schlinsog. 1974/75 hat Kunert ein Buch über das Leben in der DDR geschrieben, über den Mangel, die Langeweile, die Tristheit, über das ständige Misstrauen, das Abwarten. Veröffentlicht hat er ihn jedoch nie, lesen wir. Wusste er doch, dass ein so brisanter, ein so ungehörig kritischer, und hochgradig ironischer Text niemals publiziert werden würde. Glücklicherweise, so die Rezensenten, hat er ihn nun wieder gefunden und beschlossen, dass es jetzt an der Zeit ist. Der Leser wird ihm danken, denn "Die zweite Frau" ist unterhaltsam, spannend, witzig, ehrlich, er eckt an und lässt den Leser so die ganz authentische DDR (wieder-)erleben, so Schlinsog. Ganz besonders schätzt die Rezensentin diesen kecken, humorvollen Ton, in dem Kunert auch die schmerzhaften und gefährlichen Seiten des Lebens schildert. Ein abenteuerlicher Kurztrip durch das eine Deutschland in den Siebzigern, meint die Rezensentin, und: Unbedingt lesen!
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ich habe schon lange keinen deutschsprachigen Roman gelesen, der mich so amüsiert hat.« (Gert Scobel, 3sat Buchzeit, 17.03.2019) »Einfach ein tolles Buch!« (Barbara Vinken, 3sat Buchzeit, 17.03.2019) »Der Autor ist ein Feuerwerk an Ideen.« (Sandra Kegel, 3sat Buchzeit, 17.03.2019) »Als er kürzlich aufräumte - ein Glück, dass er's tat -, fand er das längt vergessene Machwerk und fand es gar nicht schlecht. Mit Recht.« (Ulrich Greiner, Die ZEIT, 07.03.2019) »Der Lust am Erzählen gesellt sich die an der Reflexion bei.« (Jochen Schimmang, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 06.03.2019) »Eines zeichnet auch 'Die zweite Frau' (...) wieder aus, etwas, das Kunerts Sonderstatus innerhalb der DDR-Literatur hervorhebt. Und das ist Witz« (Tilman Krause, Die literarischen Welt, 02.03.2019) »Wir können nun dem Autor nicht nur zum neunzigsten Geburtstag, sondern auch zu diesem Fund gratulieren« (Helmut Böttiger, Süddeutsche Zeitung, 06.03.2019) »Dieser wunderbare, wiederentdeckte Roman hat nach 45 Jahren Schublade nichts von seinem brillanten Humor verloren.« (Romy Gehrke, MDR Thüringen Journal, 05.03.2019) »ein tollkühner Roman über die DDR« (Tim Evers, 3sat Kulturzeit, 06.03.2019) »ein sprachlich total faszinierendes Buch - elegant, geschmeidig, witzig« (Kirsten Voigt, SWR2 Lesenswert, 05.02.2019) »Ein unverhofftes Geschenk dieses glänzenden Autors an die Leser.« (Stefan Dosch, Augsburger Allgemeine, 06.03.2019) »Es ist grotesk, es ist bitter und es ist vertraut. (...) Und zeitgemäß ist es auch.« (Janina Fleischer, Leipziger Volkszeitung, 05.02.2019) »Das in der Truhe verwahrte Manuskript erweist sich als ein kunstvoll gebauter Roman, frei von Verletzungen, die ein Zahn der Zeit hineingeknabbert hätte.« (Cornelia Geißler, Berliner Zeitung, 06.02.2019) »Das lässt sich anschauen wie ein alter, gutgemachter Film. Und wie Hitchcock in seinen Filmen, huscht auch Kunert durchs Bild.« (Jürgen Verdofsky, Frankfurter Rundschau, 06.03.2019) »Auch nach gut vierzig Jahren unfreiwilliger Ruhezeit hat dieser kriminalistisch-politische Liebesroman nichts an Brisanz verloren und lässt das satirische Talent seines Verfassers aufs Prächtigste schillern.« (Katrin Hillgruber, Deutschlandfunk Büchermarkt »Buch der Woche«, 03.03.2019) »gewitzt und unterhaltsam« (Christian Eger, Mitteldeutsche Zeitung, 13.02.2019) »ein funkelndes Stück Literatur« (Elke Schlinsog, Deutschlandfunk Kultur »Buchkritik«, 14.02.2019) »ein starkes Buch, wirklich komisch. (...) sehr, sehr böse und bissig geschrieben« (Sigrid Hoff, rbb Kulturradio, 15.02.2019) »Dieses Fundstück erweist sich als ein Kunert'sches Goldstück; ironisch, skeptisch, humorvoll, geistreich« (Michael Wüstefeld, Sächsische Zeitung, 22.02.2019) »Unbedingt lesenswert« (Torsten Unger, MDR Kultur, 03.03.2019) »Ein vergnügliches Stück Literatur, das uns in einen verblichenen Staat zurückbringt.« (Reinhard Düsterhöft, Märker Zeitung, 20.03.2019) »eine glasklare Gesellschaftsanalyse« (Katrin Wenzel, MDR Kultur, 02.03.2019) »eine wortmächtige Tragikomödie über ein untergegangenes Land« (Grit Warnat, Volksstimme, 05.03.2019) »ein bezaubernder Roman, voller Fabulierkunst« (Welf Grombacher, Rheinische Post, 05.03.2019) »Dieser Roman ist ein intensives Zeitzeugnis der vergangenen DDR-Realität gleich auf mehreren Ebenen.« (Matthias Hoenig, dpa, 12.02.2019) »Damit kann man bestehen, vor sich selber und vor der Lesewelt dieser schwierigen Zeitabläufe« (Klaus Walther, Lesart 1/19, Frühjahr 2019) »Für die Kunert-Gemeinde ist dies (...) ein Leckerbissen.« (Stefan Berkholz, SR 2 KulturRadio, 06.02.2019) »frech und witzig, entlarvend und zugleich eine Warnung vor einer Verdunklung der Vernunft« (Wolf Scheller, Jüdische Allgemeine, 21.03.2019) »funkelnd und frisch« (Badische Neueste Nachrichten, 24.03.2019) »Nun erschien dieses Stück bester kafkaesker Komik - verspätet, aber nicht vergilbt.« (Hans-Dieter Schütt, neues deutschland, März 2019) »ein überaus gelungenes Werk, das den Autor als scharfen Beobachter des tristen DDR-Alltags zeigt.« (Kevin Zdiara, Allgemeine Zeitung, 31.05.2019) »Eine atemlos-wortgewaltige, satirische Tragikomödie, ein Liebesroman, ein Zeitbild der frühen 1970er-DDR-Jahre.« (F.F. dabei, 25.05.2019) »ein Roman aus der DDR, der rundheraus lustig ist, respektlos, unterhaltsam, glänzend geschrieben« (Walter Klier, Wiener Zeitung, 31.08./01.09.2019)