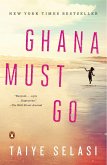Die literarische Sensation aus Amerika - ein kosmopolitischer Familienroman: In Boston, London und Ghana sind sie zu Hause, Olu, Sadie und Taiwo. Sechs Menschen, eine Familie, über Weltstädte und Kontinente zerstreut. In Afrika haben sie ihre Wurzeln und überall auf der Welt ihr Leben. Bis plötzlich der Vater in Afrika stirbt. Nach vielen Jahren sehen sie sich wieder und machen eine überraschende Entdeckung. Und sie finden das verloren geglaubte Glück - den Zusammenhalt der Familie. Endlich verstehen sie, dass die Dinge nicht einfach ohne Grund geschehen. So wurde noch kein Familienroman erzählt. Taiye Selasi ist die neue internationale Stimme - jenseits von Afrika.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Dass Ijoma Mangold nach Rom gereist ist, um Taiye Selasi für den Aufmacher der Literaturbeilage zu porträtieren, zeigt, welche Bedeutung die "Zeit" diesem Roman beimisst. Mangold zeigt sich denn auch einfach umgehauen von Selasis imposanter Erscheinung, ihrer Schönheit, Kultiviertheit und Intelligenz, meldet aber auch Bedenken an ihrem Konzept der "Afropoliten" an, in denen sie eine neue "urbane intellektuelle Avantgarde" sieht. Hier fragt er, ob dies nicht zu sehr an die Klassenprivilegien afrikanischen Eliten gebunden ist, die ihre Kindern in den USA oder Großbritannien die besten Universitäten oder Konservatorium besuchen lassen. Von einer solchen Familie handelt auch Selasis Roman, auf den Mangold am Ende seines Porträts zu sprechen kommt. Eine aus Ghana stammende Ärztefamilie in Massachusetts wird auseinandergerissen, hält aber eisern am Prinzip akademischer Hochleistung fest, so dass alle mehr oder weniger glücklich ihre Ivy-League-Karrieren verfolgen können. Wenn aus Mangolds Kritik auch eine gewisse Skepsis klingt, preist er doch vorbehaltlos die Sprache des Romans als ein "Wunder an Emotion und Intelligenz, an Härte und Wärme" und die dargestellte Familie als ein "Kraftwerk der Gefühle".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Der erste Roman über die jungen Afropolitans: Taiye Selasis Debüt "Diese Dinge geschehen nicht einfach so" ist kosmopolitisch, exotisch, engagiert. Neue Töne für das alte Genre Familienroman.
Es gibt Schriftsteller, die bereits berühmt sind, bevor ihr erstes Buch erschienen ist. Dafür gibt es nicht immer gute, aber fast immer sehr aufschlussreiche Gründe. Ein Rumor eilt solchen Autoren voran, manchmal ist es auch nur ein Foto, jedenfalls baut sich eine Erwartung auf, hier und da von unsichtbaren Händen hilfreich gestützt, die Buch und Autor zuverlässig vor sich her bläst, bis beide sicher im heimeligen Hafen der Bestsellerliste gelandet sind. Taiye Selasi scheint ein solcher Fall zu sein.
"Diese Dinge geschehen nicht einfach so" heißt ihr erster Roman, den sein deutscher Verlag als literarische Sensation aus Amerika ankündigt: "ein kosmopolitischer Familienroman". Selasi erzählt darin die Geschichte von Kwaku Sai aus Ghana und seiner nigerianischen Frau Fela, die an der amerikanischen Ostküste mit ihren vier Kindern nicht mehr erstreben als das Durchschnittsleben in bescheidenem Wohlstand, das einem hervorragenden Arzt mit glänzender Ausbildung und außergewöhnlichem Talent zusteht. Doch weil Kwaku so talentiert ist - und womöglich auch, weil er schwarz ist -, soll er eine Patientin operieren, obwohl alle wissen, dass deren Leben durch keine ärztliche Kunst zu retten ist. Die Frau stirbt auf Kwakus Operationstisch, ihre reichen Angehörigen, die das Krankenhaus schon lange finanziell unterstützen, fordern den Kopf des schwarzen Arztes. Kwaku, der Ausnahme-Chirurg, wird gefeuert.
Sein Vater, der in Ghana seiner Familie eine Buschhütte gebaut hat, soll mit erhobenem Kopf ins Meer geschritten sein, nachdem weiße Männer ihn öffentlich ausgepeitscht hatten. Kwaku wird von Scham und Ohnmacht aus seiner kleinen Ostküsten-Villa getrieben. Er verlässt Fela und die Kinder ohne ein Wort der Begründung. Als er zurückkehrt, ist das Haus leer. Die Familie ist zerfallen. So etwas passiert. Aber es passiert nicht einfach so.
Taiye Selasi beginnt ihren Roman sechzehn Jahre später, mit Kwakus Tod, dessen Schilderung sich über etwa hundert Seiten erstreckt, unterbrochen von Rückblenden und Ortswechseln. Selasi wurde der Fama nach als Studentin in Oxford von Toni Morrison entdeckt, die als erste Frau schwarzer Hautfarbe den Nobelpreis erhalten hat. Chinua Achebe, der soeben verstorbene Altmeister, gehört zu ihrer Lektüre wie die Bücher ihrer nigerianischen Generationsgenossin Chimamanda Ngozi Adichie. Und wie Jennifer Egan, John Lanchester, Peter Buwalda und andere hat sie von Jonathan Franzen gelernt, dass ein moderner Familienroman polyzentrisch aufgebaut sein muss, also möglichst viele, möglichst unterschiedliche Identifikationsangebote bereithalten sollte. Nicht zuletzt deshalb haben Kwaku und Fela vier Kinder, deren unterschiedliche Werdegänge ausführlich geschildert werden, samt den dazugehörigen Problemen von Bulimie bis Missbrauch. Olu, der Älteste, wird Arzt und will so perfekt sein, wie sein Vater es bis zu seiner Entlassung war. Die Zwillinge Kehinde und seine Schwester Taiwo, beide ungewöhnlich schön und ungewöhnlich begabt, wurden als Pubertierende vom Halbbruder ihrer Mutter Fela missbraucht. Sie hatte die Kinder nach Kwakus Flucht nach Lagos gegeben, ohne zu ahnen, was die Zwillinge im Haus des dämonischen, halbverrückten Kriminellen erwarten würde. Und Sadie, die Jüngste, geplagt von Essstörungen, unglücklich verliebt in ihre strahlende Collegefreundin Philae, leidet am meisten unter dem Zerfall der Familie, die erst wieder zusammenfindet, als Kwakus Begräbnis sie in Ghana zusammenführt.
"Diese Dinge geschehen nicht einfach so" ist tatsächlich ein kosmopolitischer Roman, der mühelos zwischen New York und Lagos, Bostons Vorort Brookline und Ghanas Hauptstadt Akkra wechselt, der in amerikanischen Kliniken und afrikanischen Hütten spielt, der die Mythen der Yoruba ebenso selbstverständlich ins Spiel bringt wie die amerikanischen Frühstücksflocken, die Felas Kinder den gestampften Süßkartoffeln ihrer Vorfahren vorziehen. Eine beachtliche erzählerische Kraft und Selasis geschickter Umgang mit den exotischen Reizen afrikanischer Kultur machen diesen Roman zur spannenden Lektüre. Zugleich ist dieses bemerkenswerte Buch der Roman zum Essay, zu jenem Essay nämlich, mit dem die Autorin vor acht Jahren einige Berühmtheit erlangt hat. Er ist die erzählerische Probe aufs politische Exempel.
In "Bye Bye, Babar" prägte Selasi im Jahr 2005 den Begriff "Afropolitan", mit dem sie junge, gut ausgebildete Afrikaner bezeichnet, die auf der ganzen Welt verstreut arbeiten und leben, keine klassische Heimat mehr haben, sondern "an vielen Orten zu Hause" sind: London, New York, Berlin, Paris. "Afropolitan" ist der Schlüsselbegriff in Selasis selbstbewusstem Manifest, mit dem eine junge Generation von Afrikanern, die mehrsprachig aufgewachsen ist, die besten Schulen und Elite-Universitäten besucht hat und zu Flexibilität und Leistungsbereitschaft erzogen wurde, nun den Anspruch erhebt, eine neue Avantgarde zu bilden: "Wir sind Afropoliten: nicht Weltbürger, sondern Weltafrikaner." Mit den Ideen von Lépold Sedar Senghor und Aimé Césaire hat das womöglich gar nicht so wenig zu tun. Wenn die Globalisierung für große Teile Afrikas die Rückkehr des Kolonialismus mit den Mitteln des internationalen Finanzmarkts bedeutet, dann ist das Konzept des Afropoliten die Rückkehr von Césaires "Négritude" in neuem Gewand. Denn neben dem schicken Weltafrikanertum, das hier ausgerufen wird, hat Selasi auch die konkreten Umstände in Afrika im Blick. Dabei denkt sie vor allem an den enorm folgenreichen "Brain drain", zu dem auch der begnadete Chirurg Kwaku beitrug. Die Zahl der hochqualifizierten jungen Afrikaner, die ihr Land verließen, lag zwischen 1960 und 1975 bei 27 000. Zwischen 1984 und 1987 waren es bereits 80 000.
Für Kwaku und mehr noch für seine Kinder geht es darum, eine Identität aufzubauen, sich, wie Selasi in ihrem Essay schreibt, "eine Identität aus völlig verschiedenen Quellen zu erfinden", und dies in einer Welt, in der schwarz nicht mehr schwarz und weiß nicht mehr weiß ist. Die vielleicht wichtigste, jedenfalls ungeheuer raffiniert konstruiert Szene in diesem Roman zeigt, wie alte Rassismus-Konzepte im einundzwanzigsten Jahrhundert wiederauftauchen, weil sie eben nicht auf Rassenunterschieden beruhen, sondern auf Machtansprüchen, Konkurrenzverhältnissen und materiellen Interessen, die ideologisch aufgeladen werden können.
Olu, mittlerweile selbst Arzt, will Ling heiraten, die Tochter von Doktor Wei. Der Chinese verweigert ihnen seinen Segen, obwohl er glaubt, dass Afrikanern wie Olu die Zukunft gehöre: "Die Asiaten sind erledigt. Wir sind fett geworden ... Jetzt sind die Afrikaner an der Reihe." Nur eines stört den alten Chinesen: "Es gibt keinen Respekt vor der Familie. Die Väter ehren ihre Kinder und Frauen nicht." Nur deshalb gebe es Kindersoldaten und Vergewaltigungen in Afrika. Wei, der Angehörige einer etablierten Minderheit, sieht auf Olu herab, den Angehörigen einer im Aufstieg begriffenen Minderheit. Beide betrachten einander, ohne dass sie dies bemerken würden, mit den Augen der Mehrheit. Taiye Selasi hat einen Roman geschrieben, der daran etwas ändern will.
HUBERT SPIEGEL.
Taiye Selasi: "Diese Dinge geschehen nicht einfach so". Roman.
Aus dem Amerikanischen von Adelheid Zöfel. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2013. 400 S., geb., 21,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Sie schreibt so berührend, fast poetisch, dass es ihr gelingt, Fantasie und Gedanken ihrer Leser anzuregen wie es nur ein Buch vermag. Norddeutscher Rundfunk, NDR 2 201306
Dass Ijoma Mangold nach Rom gereist ist, um Taiye Selasi für den Aufmacher der Literaturbeilage zu porträtieren, zeigt, welche Bedeutung die "Zeit" diesem Roman beimisst. Mangold zeigt sich denn auch einfach umgehauen von Selasis imposanter Erscheinung, ihrer Schönheit, Kultiviertheit und Intelligenz, meldet aber auch Bedenken an ihrem Konzept der "Afropoliten" an, in denen sie eine neue "urbane intellektuelle Avantgarde" sieht. Hier fragt er, ob dies nicht zu sehr an die Klassenprivilegien afrikanischen Eliten gebunden ist, die ihre Kindern in den USA oder Großbritannien die besten Universitäten oder Konservatorium besuchen lassen. Von einer solchen Familie handelt auch Selasis Roman, auf den Mangold am Ende seines Porträts zu sprechen kommt. Eine aus Ghana stammende Ärztefamilie in Massachusetts wird auseinandergerissen, hält aber eisern am Prinzip akademischer Hochleistung fest, so dass alle mehr oder weniger glücklich ihre Ivy-League-Karrieren verfolgen können. Wenn aus Mangolds Kritik auch eine gewisse Skepsis klingt, preist er doch vorbehaltlos die Sprache des Romans als ein "Wunder an Emotion und Intelligenz, an Härte und Wärme" und die dargestellte Familie als ein "Kraftwerk der Gefühle".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH