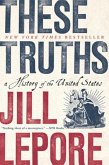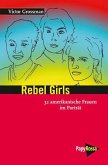WELTMACHT AM SCHEIDEWEG - JILL LEPORES BRILLANTE GESCHICHTE AMERIKAS
Die Amerikaner stammen von Eroberern und Eroberten, von Menschen die als Sklaven gehalten wurden, und von Menschen die Sklaven hielten, von der Union und von der Konföderation, von Protestanten und von den Juden, von Muslimen und von Katholiken, von Einwanderern und von Menschen, die dafür gekämpft haben, die Einwanderung zu beenden. In der amerikanischen Geschichte ist manchmal - wie in fast allen Nationalgeschichten - der Schurke des einen der Held des anderen. Aber dieses Argument bezieht sich auf die Fragen der Ideologie: Die Vereinigten Staaten sind auf Basis eines Grundbestands von Ideen und Vorstellungen gegründet worden, aber die Amerikaner sind inzwischen so gespalten, dass sie sich nicht mehr darin einig sind, wenn sie es denn jemals waren, welche Ideen und Vorstellungen das sind und waren."
Aus der Einleitung
In einer Prosa von funkelnder Schönheit erzählt die preisgekrönte Historikerin Jill Lepore die Geschichte der USA von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Sie schildert sie im Spiegel jener «Wahrheiten» (Thomas Jefferson), auf deren Fundament die Nation gegründet wurde: der Ideen von der Gleichheit aller Menschen, ihren naturgegebenen Rechten und der Volkssouveränität. Meisterhaft verknüpft sie dabei das widersprüchliche Ringen um den richtigen Weg Amerikas mit den Menschen, die seine Geschichte gestaltet oder durchlitten haben. Sklaverei und Rassendiskriminierung kommen ebenso zur Sprache wie der Kampf für die Gleichberechtigung der Frauen oder die wachsende Bedeutung der Medien. Jill Lepores große Gesamtdarstellung ist aufregend modern und direkt, eine Geschichte der politischen Kultur, die neue Wege beschreitet und das historische Geschehen geradezu hautnah lebendig werden lässt.
Das fulminante Portrait einer Nation
Von den Anfängen bis zur heutigen Weltmacht in der Krise
"Jeder, der sich für die Zukunft Amerikas interessiert, muss dieses Buch lesen. Lepore macht alles lebendig, das Gute, das Schlechte, das Schöne und das Hässliche". Lynn Hunt
Die Amerikaner stammen von Eroberern und Eroberten, von Menschen die als Sklaven gehalten wurden, und von Menschen die Sklaven hielten, von der Union und von der Konföderation, von Protestanten und von den Juden, von Muslimen und von Katholiken, von Einwanderern und von Menschen, die dafür gekämpft haben, die Einwanderung zu beenden. In der amerikanischen Geschichte ist manchmal - wie in fast allen Nationalgeschichten - der Schurke des einen der Held des anderen. Aber dieses Argument bezieht sich auf die Fragen der Ideologie: Die Vereinigten Staaten sind auf Basis eines Grundbestands von Ideen und Vorstellungen gegründet worden, aber die Amerikaner sind inzwischen so gespalten, dass sie sich nicht mehr darin einig sind, wenn sie es denn jemals waren, welche Ideen und Vorstellungen das sind und waren."
Aus der Einleitung
In einer Prosa von funkelnder Schönheit erzählt die preisgekrönte Historikerin Jill Lepore die Geschichte der USA von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Sie schildert sie im Spiegel jener «Wahrheiten» (Thomas Jefferson), auf deren Fundament die Nation gegründet wurde: der Ideen von der Gleichheit aller Menschen, ihren naturgegebenen Rechten und der Volkssouveränität. Meisterhaft verknüpft sie dabei das widersprüchliche Ringen um den richtigen Weg Amerikas mit den Menschen, die seine Geschichte gestaltet oder durchlitten haben. Sklaverei und Rassendiskriminierung kommen ebenso zur Sprache wie der Kampf für die Gleichberechtigung der Frauen oder die wachsende Bedeutung der Medien. Jill Lepores große Gesamtdarstellung ist aufregend modern und direkt, eine Geschichte der politischen Kultur, die neue Wege beschreitet und das historische Geschehen geradezu hautnah lebendig werden lässt.
Das fulminante Portrait einer Nation
Von den Anfängen bis zur heutigen Weltmacht in der Krise
"Jeder, der sich für die Zukunft Amerikas interessiert, muss dieses Buch lesen. Lepore macht alles lebendig, das Gute, das Schlechte, das Schöne und das Hässliche". Lynn Hunt

Die Vereinigten Staaten sind auf Menschenrechte gegründet. Aber auch auf den Verstoß dagegen. Das muss man wissen, wenn man Amerikas Gegenwart verstehen will: Über Jill Lepore und ihr wegweisendes Geschichtsbuch "Diese Wahrheiten" Von Tobias Rüther
Das Buch ist gewichtig, und es hat einen nicht weniger gewaltigen Titel: "Diese Wahrheiten", so hat Jill Lepore ihre elfhundertseitige Geschichte Amerikas genannt, die jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Begonnen hatte Lepore die Arbeit daran aber unter einem anderen Titel: "American History from Beginning to End". Die amerikanische Geschichte - schon zu Ende? Das war im Jahr 2014, im Weißen Haus regierte damals noch Barack Obama. Mit dessen Amtseinführung im Januar 2009 hatte Lepore, Historikerin an der Universität Harvard und Mitarbeiterin des Magazins "The New Yorker", ihr Projekt einer populären Geschichte von Kolumbus bis in die Gegenwart eigentlich abschließen wollen. Sie fand diesen Arbeitstitel witzig, "funny", sagt sie, und er hätte ja auch gepasst: weil es Gründe gab anzunehmen, dass sich mit der Wahl des ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten, deren Fundamente afrikanische Sklaven gelegt hatten, etwas fügte, eine Epoche endete.
Aber dann wurde im November 2016 Donald Trump zu Obamas Nachfolger gewählt. Und damit, sagt Lepore heute, auf Deutschlandbesuch in den Frankfurter Buchmessetagen, klang ihre Pointe vom Anfang und Ende Amerikas plötzlich "wie eine Anklage. Wie ein Angriff auf Trump." So sei das Buch aber nicht gedacht, denn: "Ich mische mich nicht in politische Kriegsführung ein." Sie habe vielmehr ein Geschichtsbuch in der Tradition großangelegter Gesamtdarstellungen im Sinn gehabt, die etwas aus der Mode gekommen seien: ein Lesebuch für jeden Haushalt, welches die Lektüre vieler anderer, detaillierter Bücher ersetzt. Und so bekam es einen neuen Titel: "Diese Wahrheiten". Der ist zwar, in Zeiten von Fake News, nicht weniger politisch aufgeladen, aber davon erst später mehr.
Jill Lepore, aufgewachsen in einer Kleinstadt in Massachusetts, ist der seltene Fall einer Doppelbegabung zwischen Akademie und Journalismus. Sie lehrt und forscht seit 2003 in Harvard, inzwischen als Professorin für politische Geschichte Amerikas - und schreibt seit 2005 regelmäßig für den "New Yorker": Essays (über Technologie), Porträts (über die Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsberg), Literaturkritiken (über Kinderbücher) und sehr persönliche Geschichten, zuletzt, im Juli dieses Jahres, über den Verlust ihrer besten Freundin Jane; ein ergreifender Text über Lebensziele, Freundschaft, verlorene und geborene Babys und Bücher.
Sie habe immer schreiben wollen, erzählt Jill Lepore an diesem Morgen nach ihrem Auftritt beim Buchmesse-Empfang ihres deutschen Verlages - und wenn man jetzt für den "New Yorker" ein Porträt über sie schriebe, dann müsste man, wie es die Tradition dieses Magazins ist, auch erwähnen, was Jill Lepore trägt, während sie den Kaffee vom Frühstücksbuffet ihres Hotels am Frankfurter Hauptbahnhof austrinkt: einen schwarzen Rollkragenpullover und eine schwarzweiße Brille. Sie ist Baseballfan (Boston Red Sox) und spricht schnell, und das, vermutlich, weil sie auch schnell denkt und offenbar vom Denken gute Laune kriegt, jedenfalls lacht sie oft.
Ihr Auftritt beim ehrwürdigen Verlagsempfang von C. H. Beck am Abend zuvor hatte Lepores Doppelbegabung zwischen Erzählen und Forschen schön in Szene gesetzt: Lepore hatte ihr Publikum gleichzeitig unterhalten und unterrichtet - und kurz und knapp anhand der Illustrationen ihres Buchs erklärt, worum es geht. "Diese Wahrheiten", das sind jene, die im ersten Satz der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 beschworen werden: "Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich: dass alle Menschen gleich geschaffen sind", so erklärten es die Gründer der Vereinigten Staaten, als sie sich von der britischen Krone lossagten. Doch zu diesen Wahrheiten gehört eben auch, und das macht Lepores Buch unmissverständlich klar: dass sie eben von Anfang an nicht wahr waren. Nicht ganz wahr: Sie galten lange nicht für alle, sondern nur für weiße Männer.
"Eine in Widersprüchen geborene Nation, mit Freiheit in einem Land der Sklaverei und Souveränität in einem eroberten Land, wird für alle Zeit über die Bedeutung ihrer eigenen Geschichte streiten", schreibt Lepore. Die Spannungen zwischen den offenbaren Wahrheiten der Verfassung - die freien und gleichen Menschen ein freies Zuhause garantiert - und der Wirklichkeit einer von Anfang an ungleichen Bevölkerung beschäftigen die Vereinigten Staaten bis heute. Lepore erzählt von einer Nation, die im Widerspruch geboren wurde, weil in jenem Augenblick, als sie in ihrer Unabhängigkeitserklärung emphatisch für alle Zeiten und in alle Welt hinausrief, dass alle Menschen gleich sind und sich das ja wohl von selbst erkläre: auf amerikanischem Boden rechtlose Sklaven lebten und starben, starben, starben. Und Indianer vertrieben und ausgerottet wurden. Und die Frauen nicht bestimmen durften, nicht über sich selbst und erst recht nicht die Politik.
In charmanter Unerbittlichkeit kehrt Lepore immer wieder zu diesem Widerspruch zurück, sie lässt nicht locker, sie geht mit ihren Figuren durch die Jahrhunderte und findet den Widerspruch wieder und wieder: beim ersten Präsidenten, George Washington, der, als er 1789 vereidigt wurde, die Zähne seines Sklaven im Mund trug, weil ihm seine eigenen ausgefallen waren. Sie findet den Widerspruch auch bei Franklin D. Roosevelt, dem Präsidenten des "New Deal" und Bezwinger Hitlers, der im Zweiten Weltkrieg, nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor, die Freiheitsrechte jener Amerikaner massiv einschränkte, die japanische Wurzeln hatten.
Aber Lepore lässt den Widerspruch auch von weniger bekannten Figuren verkörpern. Wie Charles Pinckney, Gouverneur von South Carolina, der 1787 die Verfassung der Vereinigten Staaten mitunterzeichnet hatte: "In Amerika gibt es mehr Gleichheit an Stand und Vermögen als in jedem anderen Land unter der Sonne", hatte der damals erklärt. Lepore konterkariert die Emphase Pinckneys mit der Inventarliste seiner Farm, sie umfasst 45 Sklaven, die, so schreibt Lepore, "die Quelle des Reichtums der Gouverneursfamilie bildeten. Zu diesen Menschen zählten Cyrus, ein Zimmermann (dessen Wert von Pinckney mit 120 £ veranschlagt wurde), Cyrus' Kinder Charlotte (80 £), Sam (40 £) und Bella (20 £), seine Enkelin Cate (70 £) und eine sehr alte Frau namens Joan, die Cyrus' Mutter gewesen sein könnte. Pinckney gab den Wert dieser Urgroßmutter mit null an; für ihn war sie wertlos."
Als Lepore im Jahr 2014 an ihrer amerikanischen Geschichte zu schreiben begann, sammelte sich gleichzeitig, unter dem Eindruck wiederholter, tödlicher Polizeigewalt gegen schwarze Amerikaner, die "Black Lives Matter"-Bewegung auf amerikanischen Straßen. Lepore, die jahrelang die Geschichte der Sklaverei erforscht und gelehrt hatte, war konsterniert darüber, dass offenbar eine Debatte erneut notwendig wurde, die doch längst geführt worden war. "Ich habe mir damals mein Buch auch als eine Black-Lives-Matter-Geschichte vorgestellt", erzählt sie. "Zwar nicht so plakativ - aber was, wenn man die amerikanische Geschichte so erzählen würde, dass es auf alle ankommt? Und nicht mehr nur auf George Washington, Roosevelt und niemanden sonst?" Das Leben der 45 Sklaven auf Pinckneys Farm sei nicht für wert erkannt worden - beziehungsweise für ein paar Pfund. "Doch so haben diese Menschen sich selbst nicht gesehen. Die Urgroßmutter wusste, dass ihr Leben etwas wert ist. Als Historiker sind wir verpflichtet, zu versuchen zu verstehen, wie diese Urgroßmutter ihre Welt verstanden hat. Und dass Amerika eine Welt war, die auch sie geschaffen hat."
Das Inventar von Pinckneys Farm ist übrigens online erfasst, wer will, kann sich die Null ansehen, die dort als Wert der Urgroßmutter eingetragen ist.
Fortsetzung auf der folgenden Seite
Lepores Buch stützt sich einerseits auf einen Berg an Forschungsliteratur, andererseits aber auf Quellen, die längst oder immer schon zugänglich gewesen sind: Was die Wucht ihres Buchs ausmacht, ist die veränderte Perspektive, mit der Lepore auf ihr Material schaut. Oder besser: eine geweitete Perspektive, welche nicht mehr ausschließt und die versucht, immer beides in den Blick zu nehmen. Dass, zum Beispiel, die Comic-Figur Batman im Jahr 1939 das Licht der Welt erblickt hat, als die Zahl der Lynchmorde an schwarzen Amerikanern ihren Höhepunkt erreichte. "Man muss beides auf dem gleichen Kompass sehen", sagt sie. Und führt ihren historiographischen Ansatz auch auf die Erfahrungen zurück, die sie als Journalistin gemacht hat. "Es hat verändert, wie ich über Geschichte schreibe", erklärt Lepore. "In dem Sinne, dass Journalisten ein sehr ausgeprägtes ethisches Bewusstsein besitzen, was ihre Figuren angeht: Man kann niemanden hereinlegen. Man kann nicht die Verletzlichkeit eines verletzlichen Menschen zur Schau stellen, wenn dieser Mensch keine Aufmerksamkeit wünscht; wünscht er sie allerdings, kann man das tun - dann gibt es aber Regeln dafür. In der Geschichtsschreibung dagegen herrscht eine Art von Schamlosigkeit: Meine Figuren sind seit Hunderten Jahren tot, aber ich will hier meinen Beitrag zur Forschung leisten, also muss ich halt argumentieren, wie ich muss." Aber man sollte sich an den Toten ebenso wenig wie an den Lebenden vergehen - und sie so präsentieren, dass es ihnen vielleicht nicht gefällt, dass sie sich aber dennoch wiedererkennen. "Ich halte manche ethischen Grundsätze des Journalismus für sehr mächtig und wichtig."
In jener Geschichte aus dem "New Yorker", in der Jill Lepore von ihrer Freundin Jane erzählt, die an Leukämie stirbt, findet sich ein vielsagender Satz. Er fügt dem empathischen Ansatz der Historikerin Lepore eine analytische Dimension hinzu. Jane hat ihrer Studienfreundin Jill ihren Laptop vererbt, und die schaltet ihn nun an, zum ersten Mal, zwanzig Jahre nach dem Tod der Freundin, um zu sehen, was sich darin verbirgt. "Alle Historiker sind Gerichtsmediziner", schreibt Lepore nun. Sie sezieren, was die Menschen und ihre Welt im Innersten zusammengehalten hat, kühl, aber sorgfältig und im Bemühen, die Integrität derer zu wahren, deren Geheimnisse sie ans Licht holen.
Und in diesem Sinne ist es eine Frage der Verfassungstreue, die amerikanische Geschichte so zu erzählen, wie Jill Lepore es tut. Als eine Geschichte aller Amerikaner, auch jener, die von den Siedlern "Indianer" genannt wurden. Als eine Geschichte der Sklaven und ihrer Nachfahren, eine Geschichte der Frauen, die um Repräsentation kämpfen, der Minderheiten. Als eine Geschichte ständiger Rückschläge, der Umdeutungen und Korrekturen.
"Das Problem ist", sagt Jill Lepore, "dass unsere Geschichte so polarisiert ist wie unsere Politik, weil so vieles unserer Politik auf historischen Behauptungen beruht." Wie jener, dass der amerikanische Bürgerkrieg nicht ein Kampf des Südens gegen die Abschaffung der Sklaverei gewesen sei, sondern es vielmehr darum gegangen sei, welche Rechte die einzelnen Staaten gegenüber den anderen besitzen: Darf der Norden dem Süden vorschreiben, wie er zu leben hat? Als der Süden sich im Frühjahr 1861 vom Norden trennte und eine Konföderation bildete, gegen Lincoln, gegen den Norden, verkündete der Vizepräsident des konföderierten Südens die "große Wahrheit, dass der Neger dem weißen Mann nicht gleich ist; dass die Sklaverei . . . sein natürlicher und moralischer Zustand sei". "Die Konföderation", schreibt Lepore, "wurde auf der Vorherrschaft der Weißen gegründet." Nach dem Krieg sei es dann "politisch zweckmäßig" geworden, diese Geschichte umzudeuten - und diese neue Deutung hält sich bis heute. Und wird beschworen, wann immer es heute darum geht, das Gedenken eines konföderierten Generals zu verteidigen, dessen Statue demontiert werden soll.
Die Vorherrschaft der Weißen: White Supremacy, so steht es im Originaltext - ein historischer Begriff, der wieder im Umlauf ist, seit Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten gewählt wurde. Als ein Erklärungsmodell seiner Anziehungskraft, als Machtanspruch jener rechtsextremen Kreise, von denen Trump sich nicht klar distanziert. Als der zum Präsidenten gewählt wurde, hatte Lepore etwa die Hälfte ihres Buchs geschrieben, sie änderte den Titel und verlängerte das Projekt über Obamas Amtseinführung hinaus. Jetzt werde sie oft von Lesern gefragt, wie sie es nur geschafft habe, so schnell so viel auf einmal zu schreiben - weil das Buch einem doch alles erkläre, was mit Trump zu tun habe. ("Es hat Jahre gedauert", sagt Lepore und lacht.)
Und in der Tat klingt der neue Titel ja nicht weniger nach politischem Kommentar, mitten in der Präsidentschaft Trumps, der es mit der Wahrheit nicht genau nimmt, der Lügen und Verzerrungen als Instrument zur Zerrüttung demokratischer und gesellschaftlicher Gewissheiten einsetzt. Und es fällt auch schwer, Lepores Beharren auf der Rationalität der amerikanischen Verfassung nicht als Kommentar zu Trumps Machtparolen zu verstehen. Das Recht macht die Amerikaner zu Amerikanern, das ist das Leitmotiv dieser elfhundertseitigen Geschichte, und es ist ja das "amerikanische Dilemma" (Gunnar Myrdal) gewesen, die Nation auf das Recht zu bauen und es im gleichen Augenblick zu brechen. Dieses Dilemma begleitet die amerikanische Geschichte nicht nur von Anfang an: Es ist diese amerikanische Geschichte.
Vor einiger Zeit, erzählt Jill Lepore, sei sie ans Gericht zum Jurydienst gebeten worden - wie das in den Vereinigten Staaten üblich ist. Dort habe man erst mal ein Video gezeigt, darüber, warum eigentlich Amerikaner über Amerikaner zu Gericht sitzen und nicht mehr die Männer des Königs. Eine bunt zusammengewürfelte Gruppe habe da mit ihr gesessen, Lastwagenfahrer, Mütter, Rentner, Studenten - aber sie alle habe miteinander verbunden, "dass wir uns an die Regeln halten, auf die wir uns geeinigt haben". Und da seien ihr die Tränen gekommen. "In meinem Buch steckt ein unverstellter Patriotismus", sagt Jill Lepore. "Es hält an der Integrität fest, aufrichtig mit dem umzugehen, was man liebt."
Jill Lepore: "Diese Wahrheiten. Eine Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika". Übersetzt von Werner Roller. C. H. Beck (Historische Bibliothek der Gerda- Henkel-Stiftung), 1120 Seiten, 39,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Lepore has written the most honest accounting of our country's history that I've ever read."
The New York Times, Bill Gates
"Lepore erzählt die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika als ständigen Konflikt zwischen Liberalen und Konservativen, dem Engagement für Gleichheit und Freiheit einerseits, Unterdrückung und Spaltung andererseits."
SPIEGEL, Leick, Romain/ Neukirch, Ralf
"Die Harvard-Historikerin ist nicht nur eine herausragende Wissenschaftlerin, sondern auch eine fulminante Autorin." Die ZEIT, Roman Pletter
"Eine intellektuelle Meisterleistung, deren Lektüre Spaß macht."
AmerInidian Research
"Das ist der Goldstandard der Geschichtsschreibung."
Landeszeitung für die Lüneburger Heide, Joachim Zießler
"Ungemein lesenswert."
Damals, Anke Ortlepp
"Höchst lesenswert."
SWR2 Lesenswert Kritik, Konstantin Sakkas
"In einer brillanten Studie schreibt die Historikerin Jill Lepore die Geschichte der USA von Christoph Kolumbus bis Donald Trump. Sie zeigt darin, dass die aktuelle politische Polarisierung nicht neu ist, sondern die Nation von Anbeginn begleitet."
Deutschlandfunk, Jens Balzer
"Ein reich bebilderter, unterhaltsamer, ernsthafter Lesegenuss."
Süddeutsche Zeitung, Meredith Haaf
"Die Harvard-Historikerin Jill Lepore kritisiert in ihrem Monumentalwerk 'Diese Wahrheiten. Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika' die Allgegenwärtigkeit des Rassismus und das Scheitern liberaler Ideen."
Spiegel Bestseller, Martin Doerry
"Die bestlesbare Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Band."
Die Tageszeitung, Claus Leggewie
"Knapp 1000 Seiten plus Anhang lassen keine Frage offen und liefern tiefe Einblicke in die amerikanische Mentalität."
PM History
"It's exactly the kind of history that readers need today to understand the key struggles that have defined the United States - and to recognize that our history is always present."
The Time, The 10 Best Nonfiction Books of the 2010s Decade
"Ein Ritt durch die Geschichte, bei dem man das Land in all seinen Widersprüchen kennenlernt."
ZEIT
"Jill Lepore - eine der wichtigen intellektuellen Stimmen der USA (...) vertritt klare Positionen. Dazu ist ihr Buch trotz seines ziegelsteinartigen Umfangs sehr gut lesbar. Voller Anekdoten und kleinen Geschichten."
mdr Kultur, Stefan Nölke
"Die US-Amerikaner stammen von Eroberern und Eroberten ab. Lepore erzählt von dieser Spaltung und dem politischen Experiment, dabei doch von der Gleichheit aller auszugehen."
Die Tageszeitung, Dirk Knipphals
"Ein Geniestreich mit Aussicht auf Bestand."
Neues Deutschland, Reiner Oschmann
"Packendes Amerika-Buch."
Neue Zürcher Zeitung, Kathrin Meier-Rust
"Lepore bringt luzide auf den Punkt, was die Entstehung und das Werden der USA bis heute ausmacht."
Tagesspiegel, Thomas Speckmann
"Es ist ein intellektuelles Vergnügen."
Bayern 2, Niels Beintker
"Lepores einfühlsame Schilderungen von Ungleichheit (...) folgen zwingend aus der Frage nach der Geltung der Verfassungsversprechen in der politischen Praxis und sind der rote Faden im Gewebe dieser mitreißenden Erzählung."
F.A.Z., Paul Ingendaay
"Ein Buch, das seinesgleichen sucht: eine hochinformierte Rückschau auf die Geschichte der USA (...) ein monumentales Werk, das gerade kein Monument, kein Gedenken an mythologische Ursprünge ist, sondern leichtflüssig die hohe Kunst historischer Detektivarbeit vorführt: Lepore zeigt uns, wie sich eine Gemeinschaft wieder neu erfand und organisierte."
NZZ Geschichte, Lea Haller
"Eine völlig neue, brillant erzählte Geschichte der Vereinigten Staaten (...) ein bahnbrechendes, ach was: revolutionäres Buch über den politischen Werdegang des Landes."
ZEIT Messebeilage, Alexander Cammann
"Brillante Geschichte der USA."
Neue Zürcher Zeitung, Alfred Defago
"Ein Ritt durch die Geschichte, bei dem man das Land in all seinen Widersprüchen kennenlernt."
ZEIT-Sachbuch-Bestenliste Oktober 2019
"Lepore's brillantes Buch läutet hell wie eine Kirchenglocke - der luzide, willkommene Ertrag eines klaren Denkens und eines scharfsinnigen Verstandes."
Karen R. Long, Newsday
"Lepore verbindet die Genauigkeit und umfassende Sachkenntnis der Gelehrten mit der lyrischen Präzision einer Dichterin... Dieses Buch ist schon jetzt ein Klassiker."
Kwame Anthony Appiah
"Jeder, der sich für die Zukunft Amerikas interessiert, muss dieses Buch lesen. Eine unserer größten Historikerinnen triumphiert, wo schon so viele gescheitert sind, aus der ganzen Leinwand unserer Geschichte einen Sinn zu ziehen... Lepore macht alles lebendig, das Gute, das Schlechte, das Schöne und das Hässliche."
Lynn Hunt
"Brillant... Erst wenn man es zu lesen beginnt, begreift man, wie dringend unsere Zeit ein Buch wie dieses gebraucht hat."
Andrew Sullivan, New York Times
"Jill Lepore ist eine wirklich außergewöhnlich begabte Autorin, und 'Diese Wahrheiten' ist nichts Geringeres als ein Meisterwerk der Geschichtsschreibung. Indem sie sich mit der schmerzhaften Vergangenheit (und Gegenwart) unseres Landes intellektuell aufrichtig auseinandersetzt, hat sie ein Buch geschrieben, dass die Geschichte Amerikas einfängt in all ihrem Leiden und all ihrem Triumph."
Michael Schaub, National Public Radio
"Staunenswert... Lepore zeigt uns Bilder eines Amerika, das besser ist, als manche von uns dachten, schlimmer als sich die meisten von uns träumen lassen, und unheimlicher, als die meisten ernsthaften Geschichtsbücher jemals vermitteln."
Casey N. Cep, Harvard Magazine
The New York Times, Bill Gates
"Lepore erzählt die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika als ständigen Konflikt zwischen Liberalen und Konservativen, dem Engagement für Gleichheit und Freiheit einerseits, Unterdrückung und Spaltung andererseits."
SPIEGEL, Leick, Romain/ Neukirch, Ralf
"Die Harvard-Historikerin ist nicht nur eine herausragende Wissenschaftlerin, sondern auch eine fulminante Autorin." Die ZEIT, Roman Pletter
"Eine intellektuelle Meisterleistung, deren Lektüre Spaß macht."
AmerInidian Research
"Das ist der Goldstandard der Geschichtsschreibung."
Landeszeitung für die Lüneburger Heide, Joachim Zießler
"Ungemein lesenswert."
Damals, Anke Ortlepp
"Höchst lesenswert."
SWR2 Lesenswert Kritik, Konstantin Sakkas
"In einer brillanten Studie schreibt die Historikerin Jill Lepore die Geschichte der USA von Christoph Kolumbus bis Donald Trump. Sie zeigt darin, dass die aktuelle politische Polarisierung nicht neu ist, sondern die Nation von Anbeginn begleitet."
Deutschlandfunk, Jens Balzer
"Ein reich bebilderter, unterhaltsamer, ernsthafter Lesegenuss."
Süddeutsche Zeitung, Meredith Haaf
"Die Harvard-Historikerin Jill Lepore kritisiert in ihrem Monumentalwerk 'Diese Wahrheiten. Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika' die Allgegenwärtigkeit des Rassismus und das Scheitern liberaler Ideen."
Spiegel Bestseller, Martin Doerry
"Die bestlesbare Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Band."
Die Tageszeitung, Claus Leggewie
"Knapp 1000 Seiten plus Anhang lassen keine Frage offen und liefern tiefe Einblicke in die amerikanische Mentalität."
PM History
"It's exactly the kind of history that readers need today to understand the key struggles that have defined the United States - and to recognize that our history is always present."
The Time, The 10 Best Nonfiction Books of the 2010s Decade
"Ein Ritt durch die Geschichte, bei dem man das Land in all seinen Widersprüchen kennenlernt."
ZEIT
"Jill Lepore - eine der wichtigen intellektuellen Stimmen der USA (...) vertritt klare Positionen. Dazu ist ihr Buch trotz seines ziegelsteinartigen Umfangs sehr gut lesbar. Voller Anekdoten und kleinen Geschichten."
mdr Kultur, Stefan Nölke
"Die US-Amerikaner stammen von Eroberern und Eroberten ab. Lepore erzählt von dieser Spaltung und dem politischen Experiment, dabei doch von der Gleichheit aller auszugehen."
Die Tageszeitung, Dirk Knipphals
"Ein Geniestreich mit Aussicht auf Bestand."
Neues Deutschland, Reiner Oschmann
"Packendes Amerika-Buch."
Neue Zürcher Zeitung, Kathrin Meier-Rust
"Lepore bringt luzide auf den Punkt, was die Entstehung und das Werden der USA bis heute ausmacht."
Tagesspiegel, Thomas Speckmann
"Es ist ein intellektuelles Vergnügen."
Bayern 2, Niels Beintker
"Lepores einfühlsame Schilderungen von Ungleichheit (...) folgen zwingend aus der Frage nach der Geltung der Verfassungsversprechen in der politischen Praxis und sind der rote Faden im Gewebe dieser mitreißenden Erzählung."
F.A.Z., Paul Ingendaay
"Ein Buch, das seinesgleichen sucht: eine hochinformierte Rückschau auf die Geschichte der USA (...) ein monumentales Werk, das gerade kein Monument, kein Gedenken an mythologische Ursprünge ist, sondern leichtflüssig die hohe Kunst historischer Detektivarbeit vorführt: Lepore zeigt uns, wie sich eine Gemeinschaft wieder neu erfand und organisierte."
NZZ Geschichte, Lea Haller
"Eine völlig neue, brillant erzählte Geschichte der Vereinigten Staaten (...) ein bahnbrechendes, ach was: revolutionäres Buch über den politischen Werdegang des Landes."
ZEIT Messebeilage, Alexander Cammann
"Brillante Geschichte der USA."
Neue Zürcher Zeitung, Alfred Defago
"Ein Ritt durch die Geschichte, bei dem man das Land in all seinen Widersprüchen kennenlernt."
ZEIT-Sachbuch-Bestenliste Oktober 2019
"Lepore's brillantes Buch läutet hell wie eine Kirchenglocke - der luzide, willkommene Ertrag eines klaren Denkens und eines scharfsinnigen Verstandes."
Karen R. Long, Newsday
"Lepore verbindet die Genauigkeit und umfassende Sachkenntnis der Gelehrten mit der lyrischen Präzision einer Dichterin... Dieses Buch ist schon jetzt ein Klassiker."
Kwame Anthony Appiah
"Jeder, der sich für die Zukunft Amerikas interessiert, muss dieses Buch lesen. Eine unserer größten Historikerinnen triumphiert, wo schon so viele gescheitert sind, aus der ganzen Leinwand unserer Geschichte einen Sinn zu ziehen... Lepore macht alles lebendig, das Gute, das Schlechte, das Schöne und das Hässliche."
Lynn Hunt
"Brillant... Erst wenn man es zu lesen beginnt, begreift man, wie dringend unsere Zeit ein Buch wie dieses gebraucht hat."
Andrew Sullivan, New York Times
"Jill Lepore ist eine wirklich außergewöhnlich begabte Autorin, und 'Diese Wahrheiten' ist nichts Geringeres als ein Meisterwerk der Geschichtsschreibung. Indem sie sich mit der schmerzhaften Vergangenheit (und Gegenwart) unseres Landes intellektuell aufrichtig auseinandersetzt, hat sie ein Buch geschrieben, dass die Geschichte Amerikas einfängt in all ihrem Leiden und all ihrem Triumph."
Michael Schaub, National Public Radio
"Staunenswert... Lepore zeigt uns Bilder eines Amerika, das besser ist, als manche von uns dachten, schlimmer als sich die meisten von uns träumen lassen, und unheimlicher, als die meisten ernsthaften Geschichtsbücher jemals vermitteln."
Casey N. Cep, Harvard Magazine