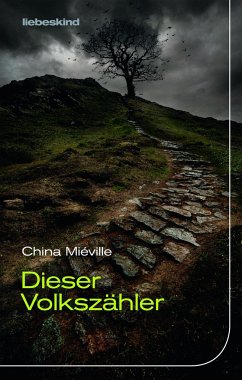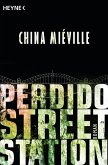Auf einem Berg oberhalb des Brückendorfes, in einem abgelegenen Haus, lebt ein Junge mit seinen Eltern. Der Vater ist Schlüsselmacher und wird weithin für seine Kunst gerühmt. Oft steigen die Leute den Berg hinauf und tragen ihr Anliegen vor. Von den Schlüsseln erzählt man sich, dass sie magische Kräfte haben, und niemals sieht der Junge die Kunden seines Vaters ein zweites Mal. Doch dann wird er Zeuge einer grausamen Tat und muss hinunter ins Dorf fliehen. Die Leute dort erwarten ihn bereits und wollen wissen, was geschehen ist. Außer Atem, mit blutigen Händen und zitternd vor Angst erzählt der Junge, seine Mutter habe seinen Vater erstochen. Sicher ist er sich aber nicht. Vielleicht war es auch der Vater, der die Mutter getötet hat ...
Einmal mehr lotet China Miéville die Grenzen der fantastischen Literatur aus. "Dieser Volkszähler" ist ein virtuos erzähltes, atmosphärisch dichtes Buch, das unsere Wahrnehmung der gegenwärtigen Welt verzerrt, um das zu enthüllen, was uns in ihr verborgen bleibt.
Einmal mehr lotet China Miéville die Grenzen der fantastischen Literatur aus. "Dieser Volkszähler" ist ein virtuos erzähltes, atmosphärisch dichtes Buch, das unsere Wahrnehmung der gegenwärtigen Welt verzerrt, um das zu enthüllen, was uns in ihr verborgen bleibt.

Die trügerisch einfache Sprache der Novelle "Dieser Volkszähler" des Schriftstellers China Miéville bringt die Literaturgattung Phantastik dazu, so unheimlich wie glasklar von sich selbst zu erzählen
Ein Junge von etwa neun Jahren kommt in ein Dorf am Fuß eines Berges gerannt, auf dem er mit seinen Eltern lebt. Atemlos klagt er, seine Mutter habe seinen Vater erstochen. Später wird er behaupten, es sei im Gegenteil der Vater gewesen, der die Mutter getötet habe. Vielleicht ist überhaupt niemand gestorben. Das Wort "vielleicht" ist im vorangegangenen Satz das wichtigste. Es sagt sehr genau, worum es in der Novelle "Dieser Volkszähler" von China Miéville geht: um Deutungsdunkelheiten.
Der Junge freilich spricht klar. Er besteht darauf, die Polizei zu einem Felsloch zu führen, in dem die Leiche liegen soll. Das Kind will nämlich gesehen haben, wie der Vater die Finsternis gelegentlich mit Tieren und Menschen fütterte: Einem Hund hat er das Genick gebrochen, einem Vogel den Hals umgedreht und außer der Mutter mindestens einen Mann ermordet. Man findet keine Spuren. Der Vater legt einen Brief der Mutter vor, in dem sie ankündigt, ihn verlassen zu wollen. Der Junge weigert sich, diesen Brief als authentisch anzuerkennen. Die Erwachsenen glauben ihm nichts; anders als eine Bande von Kindern, die in einem Haus auf einer Brücke leben, also eigentlich nirgends, nämlich weder am einen noch am andern Ufer der gespaltenen Gegend - "Eine Brücke möchte nicht sein", heißt es einmal streng. Identitäten sitzen in diesem Buch nie lange still; der Junge etwa heißt mal "er", mal "ich", mal "du" und zerfällt in der zweiten Person auch noch in einerseits sich selbst, andererseits die Leserschaft, die indes ebenso gut "man" heißen kann - im englischen Urtext, "This Census-Taker", liest man oft "you", wo das Deutsche immerhin zwischen "Sie" (das ist das lesende Bewusstsein, wie in: "seien Sie doch bitte so freundlich, mich komplett misszuverstehen") und "du" (das ist der Neunjährige - vielleicht) unterscheiden kann.
Ins ständige Sinnzittern der Novelle kann auch der Volkszähler, also die Titelfigur, keine stabile Ordnung bringen. Dieser Mann lockt zwar den Jungen aus seiner Felswelt, um ihn zum Verwaltungsträger auszubilden, aber das Ergebnis ist, dass man schließlich nicht einmal mehr weiß, ob dieser Mann wirklich die Titelfigur ist oder sich der Titel nicht vielmehr auf den Jungen bezieht, der ja schließlich auch Volkszähler wird und in dieser Funktion unter anderem drei Bücher schreibt, in drei verschiedenen Verschlüsselungen, von denen die fieseste eventuell die Behauptung ist, es gäbe diese drei Bücher überhaupt, während es in Wirklichkeit nur eins gibt, das wir lesen, weil China Miéville es geschrieben hat.
Absatz für Absatz, Seite um Seite steckt Zweifel hier jede Aussage an wie ein universeller Seuchenüberträger wehrlose Geschöpfe mit anfälligem Immunsystem. Wenn man da liest, etwas geschähe "in der Sonne", fühlt man sich bald genötigt, sich zu fragen, ob das auf der Erde und im Sonnenlicht oder im Innern des Glutballs passiert, um den die Erde sich dreht. China Miéville bringt an solchen Stellen die Kunstgattung Phantastik als Ganze zum Sprechen, nämlich deren perfides Verhältnis zur Buchstäblichkeit. Wenn in einem realistischen Text steht, "Sie verschenkte ihr Herz", ist das eine Metapher für Liebe. Wenn derselbe Satz aber in einem phantastischen Text steht, ist die zuckende Blutpumpe unter Umständen einem wirklichen Leib entnommen und entweder verzaubert (Fantasy), verflucht (übernatürlicher Horror) oder ein futuristisch biotechnisches Präparat (Science-Fiction).
Während der sechziger und siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts gab es in einem Teilbereich dieser Phantastik, nämlich in der Science-Fiction, der auch wichtige Teile des bisherigen Schaffens von China Miéville angehören, eine Bewegung namens "New Wave", die jene strategische Buchstäblichkeit auf neue, überraschende, avantgardistische Weise gebrauchte: Sie stellte damit Sachverhalte und Bewusstseinszustände dar, die sich der Buchstäblichkeit eigentlich irreduzibel entziehen oder gar verweigern - Unschärfe, Unordnung, Verstörung, wie etwa in Pamela Zolines epochaler Erzählung "The Heat Death of the Universe" von 1967, die von Entropie und Verfall handelt, was die Dichterin unter anderem damit illustriert, dass die Anzahl der Kinder der Hauptfigur nicht nur dieser selbst unbekannt ist, sondern im Laufe der Erzählung tatsächlich (eben: buchstäblich) schwankt. Je genauer Zolines genialer Text versucht, derlei Details zu fassen zu kriegen, desto mehr verschwimmen sie, wie es in der Quantenmechanik desto schwieriger wird, den Ort eines Teilchens zu bestimmen, je präziser man seinen Impuls misst.
Messungen sind bekanntlich Versprachlichungen von Beobachtungen; und als die Science-Fiction gelernt hatte, diesen Vorgang kritischer zu sehen als ihre Liebe zur Naturwissenschaft das von Haus aus verlangt, die dazu neigt, zu glauben, es ließe sich in jedem Fall einfach "sagen, was ist", hatte sie ihr höchstes überhaupt erreichbares Sprachkunstniveau erobert. In diese Zeit fielen daher zahlreiche künstlerisch maßstabsetzende Texte über den beschriebenen Zusammenhang, zum Beispiel das Experiment "Babel-17" (1966) des raffinierten Erzählers und Literaturwissenschaftlers Samuel R. Delany, in dem ein Krieg mit der gefährlichsten Waffe geführt wird, die sich Literatur vorstellen kann: einer Sprache.
Delanys Kunst hat vielerorts Schule gemacht; in Deutschland etwa verbeugt sich Clemens J. Setz hin und wieder vor ihm. Die schönste Hommage an "Babel-17", die in den letzten zwanzig Jahren publiziert wurde, stammt von China Miéville und heißt "Embassytown". In diesem Roman aus dem Jahr 2011 sprechen die Außerirdischen auf dem Planeten Arieka eine Sprache, die Menschen nicht ohne ernste Eingriffe in ihre Psychophysiologie erlernen könnten. Das ist kein Hokuspokus, sondern solide soziobiologische Spekulation auf dem Boden der evolutionären Erkenntnistheorie: Es gibt ja nicht nur Ultraschall, den wir (anders als andere Tiere) ohne Spezialmikrofone nicht hören, es gibt nicht nur extreme Bereiche des Lichtspektrums, die wir (anders als andere Tiere) ohne Spezialkameras nicht sehen können, weil unsere Sinnesorgane sich nicht in die entsprechenden rezeptiven Richtungen entwickelt haben, sondern auch manches, das wir zwar erleben, aber nicht triftig versprachlichen können (LSD-Erfahrungen zum Beispiel). Wenn das Sprechen der Wesen von Arieka in ein irdisches Idiom übersetzt wird, klingt das bei Miéville etwa so: "Die Worte, die Stadt und Maschinen sein wollten, hatten uns, damit es sie geben konnte. Als die Menschen kamen, gab es für sie keine Namen, so schufen wir neue Worte, damit die Menschen Platz auf der Welt bekamen. Wir sprachen sie in die Sprache. Sprache nahm sie auf."
Das schmeckt ein bisschen nach Heidegger, aber man sollte nicht vergessen, dass Heideggers Geraune nur eine von vielen Reaktionen der Hochmoderne auf die Verunsicherung des Alltagsverstandes durch den Zungenschlag der mathematisierten Naturwissenschaften war. Man hat diesem Zungenschlag vorgeworfen, er habe die Welt entzaubert. In Wahrheit zog seine Durchsetzung als Lingua franca der Welterschließung die größte abendländische Blüte der phantastischen Künste seit der fleißigen Mythenproduktion der Antike nach sich.
Das gröbste Missverständnis, das die rechnende Verwissenschaftlichung mit sich brachte, war die Überzeugung der Wiener logischen Positivisten Anfang des letzten Jahrhunderts, die menschliche Kultur stünde kurz vor der Beseitigung des Missverstehens an sich. Diese Leute lehrten, es gäbe überhaupt nur drei Arten von Sätzen: Solche, die von der Erfahrung bestätigt würden, solche, die von der Erfahrung widerlegt würden, und solche, bei denen beides nicht geht. Die dritte Sorte nannten sie "bedeutungslos", und hofften so, allerlei Erblasten unvernünftiger Zeiten loszuwerden. Verbannt man jedoch alles, was die Erfahrung nicht überprüfen kann, aus der Sprache, dann kann man nicht mal Naturgesetze formulieren (denn keine Erfahrung kann wissen, ob etwas "immer" und "notwendigerweise" der Fall ist, wie Naturgesetze dies verlangen).
Der Charaktertypus, den die schwierige Aufgabe, ein Mensch sein zu müssen, in Versuchung bringt, so zu denken wie diese logischen Positivisten, ist eine Sorte Person, für die sich China Miéville sehr interessiert; deshalb schmeißt er mit Vorliebe Gestalten, die glauben, sie wüssten, was los ist, in Situationen, in denen sich das nicht sagen lässt - ob er nun einen Comic schreibt wie seine Version der Serie "Dial H" für den Verlag DC, wo es Individuen aus Rauch gibt oder Helden, die ihre Kraft aus der Verzweiflung anderer beziehen, oder ob er das Projekt einer Vereindeutigung von Sprache und Wirklichkeit wie in "Dieser Volkszähler" ins Zwielicht einer unüberprüfbaren Mordanklage zerrt. Der Volkszähler will, liest man, "erfassen, veranschlagen, Interessen durchsetzen", wobei diese "Interessen" auch "Zinsen" sein könnten, denn im Original lautet die Aufzählung: "Take accounts, keep estimates, realize interests."
Mehrdeutigkeit war einmal das Vorrecht des Übernatürlichen - in der jüdisch-christlichen Philologie gibt es den sogenannten "vierfachen Schriftsinn", wonach jeder Psalm, jede Jesus-Geschichte erstens eine buchstäbliche, zweitens eine moralisch-predigende, drittens eine allegorisch-welterklärende und viertens eine mystisch-endzeitliche Bedeutung trägt. Als der Modernist William Empson die Sache untersuchte, stieß er sogar auf sieben Sorten Mehrdeutigkeit, "Seven Types of Ambiguity" (1930), von der Multivalenz sprachlicher Einzelheiten über die produktive Verwirrung bis hin zum offenen Widerspruch.
In unserer Gegenwart gehört das Erbe des logischen Positivismus den Computern, die große Mengen von Daten sammeln, vergleichen und in Reihen mit dem Zweck der Verlängerung ins überprüfbar Prognostische einfügen. Sie können das schneller als wir, aber wer daraus schließen wollte, sie wären mit einer besseren Auffassungsgabe gerüstet, beginge denselben Kategorienfehler wie jemand, der glaubt, eine Squash-Wand spiele besser Tennis als Serena Williams, weil sie den Ball immer wieder zurückhaut und dabei nie ermüdet.
Menschen mögen Daten langsamer sammeln und vergleichen als Apparate. Aber, flüstert China Miévilles leise Stimme der phantastischen Vernunft in "Dieser Volkszähler", wir sind unübertrefflich darin, die Welt so zu verwirren, dass sie uns als die interessanteste Herausforderung ihrer Einheit respektieren muss, die sie je hervorgebracht hat.
DIETMAR DATH
China Miéville: "Dieser Volkszähler". Aus dem Englischen von Peter Torberg. Liebeskind, 176 Seiten, 18 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main