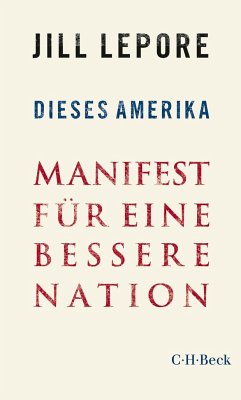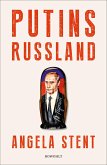Während die liberalen Demokratien weltweit unter Druck geraten und in den USA Präsident Trump eine zweite Amtszeit anstrebt, legt die gefeierte Historikerin Jill Lepore ein Manifest vor, das dem Rechtspopulismus eine seiner Lieblingsvokabeln streitig macht - die Nation. Die liberalen Eliten, so Lepore, haben die Nation viel zu lange den Rechten überlassen und zahlen dafür nun einen hohen Preis: Der neue Nationalismus von rechts verschlingt den Liberalismus. Es wird Zeit, die Nation zurückzugewinnen.
Im Zeitalter der Globalisierung und der kosmopolitischen Eliten schien die Nation ein obsoleter Begriff geworden zu sein: Eine Vokabel, deren Gehalt sich auf dem Weg zur Weltgesellschaft historisch überlebt hatte, eine Parole der Reaktion. Doch in einer Welt, die nach wie vor aus Nationalstaaten besteht, bleibt die Nation der verlässlichste Garant für Recht und Gesetz und das wirkungsvollste Instrument, um die Macht der Vorurteile, Intoleranz und Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Das war historisch so, wie die Harvard-Historikerin Jill Lepore am Beispiel der USA zeigt, und das gilt für die Gegenwart. Wer den Liberalismus gegen die autoritäre Welle unserer Zeit verteidigen will, der muss die Nation neu denken - und besser als die falschen Herolde des Nationalismus.
Im Zeitalter der Globalisierung und der kosmopolitischen Eliten schien die Nation ein obsoleter Begriff geworden zu sein: Eine Vokabel, deren Gehalt sich auf dem Weg zur Weltgesellschaft historisch überlebt hatte, eine Parole der Reaktion. Doch in einer Welt, die nach wie vor aus Nationalstaaten besteht, bleibt die Nation der verlässlichste Garant für Recht und Gesetz und das wirkungsvollste Instrument, um die Macht der Vorurteile, Intoleranz und Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Das war historisch so, wie die Harvard-Historikerin Jill Lepore am Beispiel der USA zeigt, und das gilt für die Gegenwart. Wer den Liberalismus gegen die autoritäre Welle unserer Zeit verteidigen will, der muss die Nation neu denken - und besser als die falschen Herolde des Nationalismus.
„Eine äußerst seltene Angelegenheit“
Die Historikerin Jill Lepore, Autorin der gefeierten Nationalgeschichte „Diese Wahrheiten“, mahnt die Liberalen in den USA, die Nation für sich zurückzugewinnen
Die Nation als politisches Gebilde und Vorstellung ist nicht der Stoff, aus dem liberale oder progressive Träume heute gemacht sind. Die postmoderne Linke lehnt, vereinfacht gesagt, den Nationalstaat als Raum von Macht und Ausschluss ab, die radikale Linke als Handlanger des Kapitals. Die meisten Normalliberalen interessieren sich mehr für globale Informations- und Handelsflüsse und internationale Gerechtigkeitsfragen als für das, was ihr Land für andere tun könnte, oder sie für ihr Land.
Das ist für die amerikanische Historikerin und Journalistin Jill Lepore ein theoretisches und politisches Grundsatzproblem, das sie am Aussterben der Nationalgeschichtsschreibung verdeutlicht: „Nationen brauchen, wenn sie sich selbst einen Sinn geben wollen, eine Art von Vergangenheit, auf die man sich einigen kann. Sie können das von Wissenschaftlern bekommen, oder sie können sich an Demagogen halten.“ Mit ihrem Großwerk „Diese Wahrheiten“ (C.H. Beck, siehe Süddeutsche Zeitung vom 18. November) legte Lepore 2019 bereits eine Art neue Nationalgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika vor, in der sie den Stimmen, Interessen und Perspektiven all jener Rechnung trug, die in der klassischen amerikanischen Geschichtsschreibung bisher nur das Untergrundrauschen der Überwältigung und Unterdrückung bildeten.
In dem kleinen Folgeband „Dieses Amerika. Manifest für eine bessere Nation“ ruft sie erneut Sprecher der Anti-Sklaverei-Bewegung, Aktivistinnen der Frauenemanzipation und Führer der indigenen Stämme Amerikas als Kronzeugen an für ihre These, dass die Nation sehr wohl ein passendes Gefäß für einen echten, egalitären Liberalismus ist: „Liberalismus ist der Glaube, dass die Menschen gut sind und frei sein sollten und dass sie Regierungen einsetzen, um diese Freiheit zu garantieren. Der Nationalismus und der Liberalismus wurden aus demselben Grundstoff geformt. Nationen sind Kollektive, und der Liberalismus bezieht sich auf Individuen; liberale Nationen sind Ansammlungen von Individuen, deren Rechte als Bürger von Nationen garantiert werden.“ Und keine Nation sei so passend wie die amerikanische, die kein Nationalstaat, sondern genau genommen „eine Staatsnation, eine äußerst seltene Angelegenheit“ sei.
In diesem klaren, gelegentlich grundkurshaften Stil ist der gesamte Text gehalten, der sich mit seinen zehn übersichtlichen Kapiteln auf 150 Seiten gut in einem intensiven Rutsch bewältigen lässt. Lepore liefert einen Schnellritt durch die bewegte Geistesgeschichte liberaler Staatstheorie und skizziert anhand verschiedener Beispiele, wie stark die Nationwerdung der USA von Anfang an durch Differenz, Konflikt und Auseinandersetzung bestimmt war. Jene Eigenschaft, die vielen Beobachtern und auch liberalen Amerikanern selbst als Zeichen einer fundamentalen nationalen Dysfunktionalität gilt – die extremen juristischen, politischen und rhetorischen Konflikte um ganz elementare Verfassungsfragen – sieht sie als schützenswerten und außergewöhnlichen Kern Amerikas: „Die Nation ist der Kampf“, schreibt sie gleich an zwei Stellen.
Dieser Kampf drehte sich von früh an um die Frage, wer wirklich dazugehörte und wer nicht. Eine Vielzahl von verheerenden Niederlagen erlebten dabei nicht nur die schwarzen Amerikaner, sondern auch die Angehörigen der indigenen Stämme. Eine solche Niederlage war der erniedrigende Dawes Act von 1887, der indigenen Amerikanern die Staatsbürgerschaft bewilligte, wenn sie sich von ihrem Stamm trennten. Zuzüglich erhielten sie ein Stück Land und ein symbolisches Abschiedsgeschenk – Pfeil und Bogen für die Männer, eine Handarbeitstasche für die Frauen. Lepore nutzt paradoxerweise dieses Gesetz, um zu argumentieren, dass in jedem elenden Akt der US-Machthaber auch ein edler Funke des Widerstands wohnt: „Segregation, Exklusion und die mit dem Dawes Act verbundene Staatsbürgerschaft als Gegenleistung verrieten den Geist, die liberalen Versprechen und die verfassungsrechtlichen Garantien des 14. und 15. Zusatzartikels. Aber der Kampf, mit dem die Nation an diesen Versprechen gemessen wurde, sollte eine liberale Tradition fortführen, eine Tradition, die bürgerschaftliche Ideale wertschätzte und Forderungen für die Nation erhob.“
Das ist etwas hölzern ins Deutsche übertragen, und man muss sich intellektuell und politisch schon ein wenig verrenken, um Lepore zu folgen. Doch gelangt man, bei allen Widersprüchen, genau an die süße Stelle zwischen ziemlich genial und völlig absurd. Anders gesagt, da, wo es richtig interessant wird. Was auch nur eine Beschreibung für dieses Amerika ist.
MEREDITH HAAF
Manche Widersprüche führen
an die süße Stelle zwischen
ziemlich genial und völlig absurd
Bürgerwut mit Symbolgehalt: Demonstration gegen die Wahl von Donald Trump als US-Präsident im November 2016 in Oakland, Kalifornien.
Foto: Josh Edelson / AFP
Jill Lepore:
Dieses Amerika.
Manifest für eine bessere Nation. Aus dem Englischen von Werner Roller. Verlag C.H. Beck,
München, 2020.
158 Seiten. 14,95 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
Die Historikerin Jill Lepore, Autorin der gefeierten Nationalgeschichte „Diese Wahrheiten“, mahnt die Liberalen in den USA, die Nation für sich zurückzugewinnen
Die Nation als politisches Gebilde und Vorstellung ist nicht der Stoff, aus dem liberale oder progressive Träume heute gemacht sind. Die postmoderne Linke lehnt, vereinfacht gesagt, den Nationalstaat als Raum von Macht und Ausschluss ab, die radikale Linke als Handlanger des Kapitals. Die meisten Normalliberalen interessieren sich mehr für globale Informations- und Handelsflüsse und internationale Gerechtigkeitsfragen als für das, was ihr Land für andere tun könnte, oder sie für ihr Land.
Das ist für die amerikanische Historikerin und Journalistin Jill Lepore ein theoretisches und politisches Grundsatzproblem, das sie am Aussterben der Nationalgeschichtsschreibung verdeutlicht: „Nationen brauchen, wenn sie sich selbst einen Sinn geben wollen, eine Art von Vergangenheit, auf die man sich einigen kann. Sie können das von Wissenschaftlern bekommen, oder sie können sich an Demagogen halten.“ Mit ihrem Großwerk „Diese Wahrheiten“ (C.H. Beck, siehe Süddeutsche Zeitung vom 18. November) legte Lepore 2019 bereits eine Art neue Nationalgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika vor, in der sie den Stimmen, Interessen und Perspektiven all jener Rechnung trug, die in der klassischen amerikanischen Geschichtsschreibung bisher nur das Untergrundrauschen der Überwältigung und Unterdrückung bildeten.
In dem kleinen Folgeband „Dieses Amerika. Manifest für eine bessere Nation“ ruft sie erneut Sprecher der Anti-Sklaverei-Bewegung, Aktivistinnen der Frauenemanzipation und Führer der indigenen Stämme Amerikas als Kronzeugen an für ihre These, dass die Nation sehr wohl ein passendes Gefäß für einen echten, egalitären Liberalismus ist: „Liberalismus ist der Glaube, dass die Menschen gut sind und frei sein sollten und dass sie Regierungen einsetzen, um diese Freiheit zu garantieren. Der Nationalismus und der Liberalismus wurden aus demselben Grundstoff geformt. Nationen sind Kollektive, und der Liberalismus bezieht sich auf Individuen; liberale Nationen sind Ansammlungen von Individuen, deren Rechte als Bürger von Nationen garantiert werden.“ Und keine Nation sei so passend wie die amerikanische, die kein Nationalstaat, sondern genau genommen „eine Staatsnation, eine äußerst seltene Angelegenheit“ sei.
In diesem klaren, gelegentlich grundkurshaften Stil ist der gesamte Text gehalten, der sich mit seinen zehn übersichtlichen Kapiteln auf 150 Seiten gut in einem intensiven Rutsch bewältigen lässt. Lepore liefert einen Schnellritt durch die bewegte Geistesgeschichte liberaler Staatstheorie und skizziert anhand verschiedener Beispiele, wie stark die Nationwerdung der USA von Anfang an durch Differenz, Konflikt und Auseinandersetzung bestimmt war. Jene Eigenschaft, die vielen Beobachtern und auch liberalen Amerikanern selbst als Zeichen einer fundamentalen nationalen Dysfunktionalität gilt – die extremen juristischen, politischen und rhetorischen Konflikte um ganz elementare Verfassungsfragen – sieht sie als schützenswerten und außergewöhnlichen Kern Amerikas: „Die Nation ist der Kampf“, schreibt sie gleich an zwei Stellen.
Dieser Kampf drehte sich von früh an um die Frage, wer wirklich dazugehörte und wer nicht. Eine Vielzahl von verheerenden Niederlagen erlebten dabei nicht nur die schwarzen Amerikaner, sondern auch die Angehörigen der indigenen Stämme. Eine solche Niederlage war der erniedrigende Dawes Act von 1887, der indigenen Amerikanern die Staatsbürgerschaft bewilligte, wenn sie sich von ihrem Stamm trennten. Zuzüglich erhielten sie ein Stück Land und ein symbolisches Abschiedsgeschenk – Pfeil und Bogen für die Männer, eine Handarbeitstasche für die Frauen. Lepore nutzt paradoxerweise dieses Gesetz, um zu argumentieren, dass in jedem elenden Akt der US-Machthaber auch ein edler Funke des Widerstands wohnt: „Segregation, Exklusion und die mit dem Dawes Act verbundene Staatsbürgerschaft als Gegenleistung verrieten den Geist, die liberalen Versprechen und die verfassungsrechtlichen Garantien des 14. und 15. Zusatzartikels. Aber der Kampf, mit dem die Nation an diesen Versprechen gemessen wurde, sollte eine liberale Tradition fortführen, eine Tradition, die bürgerschaftliche Ideale wertschätzte und Forderungen für die Nation erhob.“
Das ist etwas hölzern ins Deutsche übertragen, und man muss sich intellektuell und politisch schon ein wenig verrenken, um Lepore zu folgen. Doch gelangt man, bei allen Widersprüchen, genau an die süße Stelle zwischen ziemlich genial und völlig absurd. Anders gesagt, da, wo es richtig interessant wird. Was auch nur eine Beschreibung für dieses Amerika ist.
MEREDITH HAAF
Manche Widersprüche führen
an die süße Stelle zwischen
ziemlich genial und völlig absurd
Bürgerwut mit Symbolgehalt: Demonstration gegen die Wahl von Donald Trump als US-Präsident im November 2016 in Oakland, Kalifornien.
Foto: Josh Edelson / AFP
Jill Lepore:
Dieses Amerika.
Manifest für eine bessere Nation. Aus dem Englischen von Werner Roller. Verlag C.H. Beck,
München, 2020.
158 Seiten. 14,95 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de

Die Nation darf man nicht den Nationalisten überlassen: Jill Lepore legt einen streitbaren Essay vor.
Jill Lepore hat mit "Dieses Amerika" einen streitbaren Essay vorgelegt, der den Geist des Konflikts zwischen dem liberalen und dem offen nationalistischen Amerika eines Donald Trump atmet. Die in Harvard lehrende Historikerin und Publizistin will den amerikanischen Nationalstaat gegen die kulturellen Hegemonialansprüche eines ethnozentrischen Nationalismus im Stile des allgegenwärtigen "America First" für ein liberales, weltoffenes, zivilbürgerliches Verständnis zurückgewinnen. Dabei setzt sie sich gleichermaßen von einer linksliberal gepflegten Transnationalisierung und Relativierung des Nationalstaates ab wie von einem isolationistischen Nationalismus.
In dieser doppelten Frontstellung gründet die Ambivalenz des Essays. Einerseits ist es berechtigt, auf die normative Macht des Faktischen hinzuweisen, wenn es um die historiographische Bedeutung des Nationalen und des Nationalstaates geht. Viel zu oft haben die berechtigte Kritik an den Gewaltexzessen im Namen von Nation und Volk oder Rasse genauso wie an der daraus resultierenden Sehnsucht nach der baldigen Überwindung des Nationalen dazu geführt, sich zu schnell über die Nation als Kategorie der historischen Erzählung hinwegzusetzen. Wodurch die Auseinandersetzung um das Selbstverständnis der Nation viel zu rasch Ideologen überlassen wurde, denen es um die mythische Überhöhung des Nationalen ging.
Aus diesem Grund bemüht sich Lepore um eine klare Differenzierung zwischen der staatsbürgerlichen, auf Partizipation beruhenden Nation einerseits und einem aggressiven Nationalismus auf der anderen Seite. Sie bietet einen Überblick über Kernmomente der amerikanischen und europäischen Geschichte und weist dabei unter anderem auf die Verquickung von Liberalismus und Nationalismus über weite Strecken des neunzehnten Jahrhunderts hin, in Europa wie in den Vereinigten Staaten.
Dieser kursorische Streifzug mag da und dort oberflächlich erscheinen, doch eine Streitschrift muss eben pointiert verfahren. Allerdings sollte eine differenzierte Argumentation dabei nicht ganz auf der Strecke bleiben. Es gab und gibt Gründe, warum die Geschichtsschreibung der vergangenen Jahrzehnte sich dem Konzept des Nationalstaates nur mit Vorbehalten näherte. So entkommt Lepore, aller Vorsicht zum Trotz, nicht der Falle, den von ihr gegen die nationalistischen Mythen in Stellung gebrachten Begriff der liberalen Bürgernation bedenkenlos zu idealisieren. Insbesondere greift sie die Vorstellung, die Vereinigten Staaten seien eine von allen anderen unterschiedene, zu einer spezifischen liberalen Mission berufene Nation, mit einer geradezu rührenden Naivität auf.
Sie kann an dieser Idee letztlich nur festhalten, indem sie durchweg den "guten" Bürgernationalismus vom "bösen" konservativen Nationalismus trennt. Heuristisch und in moralischer Hinsicht mag das angehen, aber in der Realität kommen beide Formen des Nationalen niemals voneinander getrennt in Reinform vor. Übersehen ist dabei auch, dass die Idee der amerikanischen Exzeptionalität selbst eine Geschichte hat, die als weiße, angelsächsisch-protestantische, liberale, nationalidentitäre Wiedervereinigungserzählung in der Zeit nach dem Bürgerkrieg ihren Anfang nahm, also selbst nur bedingt integrativ ist. Schwarze, Indianer, Latinos, Katholiken und asiatische Migranten waren nicht notwendig mitgedacht, meist sogar explizit ausgeschlossen, wenn in den achtziger und neunziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts vom "American Exceptionalism" die Rede war.
Noch weniger war diese Rede universalistisch gedacht. Aber genau diesen Universalismus benötigt Lepore, um den behaupteten liberal-bürgerschaftlichen Exzeptionalitätsanspruch der Vereinigten Staaten national wie international als vorbildhaft zur Geltung zu bringen. Es ist ein idealistischer Glaubensakt, den sie hier vollzieht. Denn die dunklen Seiten der amerikanischen Geschichte - etwa Sklaverei, die Unterdrückung der Indianer, Imperialismus oder die McCarthy-Ära - werden von ihr dem "bösen" Nationalismus in die Schuhe geschoben, während die liberale Nation beständig die Freiheit propagierte und nichts als die Freiheit.
Um diesen Anspruch aufrechtzuerhalten, werden Pappkameraden in großer Zahl aufgebaut. Lepore übernimmt etwa unreflektiert die schwarze Legende spanischer Kolonialherrschaft, ebenso wie sie von der britischen Kolonialherrschaft vollkommen zu Unrecht als Tyrannei spricht. Weder setzt sie sich mit dem liberalen Messianismus und seinen mörderischen Folgen in Vietnam, Indonesien oder gegenwärtig im arabischen Raum auseinander, noch geht sie auf das fragwürdige Verhältnis von bürgerlich-elitärem Liberalismus und Massendemokratie oder gar von Liberalismus und Kapitalismus ein.
Wenn man alle schwarzen Flecken weglässt, bleibt die Weste des Liberalismus blütenrein. Dieses Verfahren ist leider zu konstatieren - obwohl Jill Lepores Grundfrage nach der Rolle der Nation in der Geschichtsschreibung berechtigt und aktuell ist.
MICHAEL HOCHGESCHWENDER
Jill Lepore: "Dieses Amerika". Manifest für eine bessere Nation.
Aus dem Englischen von Werner Roller.
C. H. Beck Verlag, München 2020. 158 S., br., 14,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Die Historikerin Jill Lepore, Autorin der gefeierten Nationalgeschichte „Diese Wahrheiten“, mahnt die Liberalen in den USA, die Nation für sich zurückzugewinnen
Die Nation als politisches Gebilde und Vorstellung ist nicht der Stoff, aus dem liberale oder progressive Träume heute gemacht sind. Die postmoderne Linke lehnt, vereinfacht gesagt, den Nationalstaat als Raum von Macht und Ausschluss ab, die radikale Linke als Handlanger des Kapitals. Die meisten Normalliberalen interessieren sich mehr für globale Informations- und Handelsflüsse und internationale Gerechtigkeitsfragen als für das, was ihr Land für andere tun könnte, oder sie für ihr Land.
Das ist für die amerikanische Historikerin und Journalistin Jill Lepore ein theoretisches und politisches Grundsatzproblem, das sie am Aussterben der Nationalgeschichtsschreibung verdeutlicht: „Nationen brauchen, wenn sie sich selbst einen Sinn geben wollen, eine Art von Vergangenheit, auf die man sich einigen kann. Sie können das von Wissenschaftlern bekommen, oder sie können sich an Demagogen halten.“ Mit ihrem Großwerk „Diese Wahrheiten“ (C.H. Beck, siehe Süddeutsche Zeitung vom 18. November) legte Lepore 2019 bereits eine Art neue Nationalgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika vor, in der sie den Stimmen, Interessen und Perspektiven all jener Rechnung trug, die in der klassischen amerikanischen Geschichtsschreibung bisher nur das Untergrundrauschen der Überwältigung und Unterdrückung bildeten.
In dem kleinen Folgeband „Dieses Amerika. Manifest für eine bessere Nation“ ruft sie erneut Sprecher der Anti-Sklaverei-Bewegung, Aktivistinnen der Frauenemanzipation und Führer der indigenen Stämme Amerikas als Kronzeugen an für ihre These, dass die Nation sehr wohl ein passendes Gefäß für einen echten, egalitären Liberalismus ist: „Liberalismus ist der Glaube, dass die Menschen gut sind und frei sein sollten und dass sie Regierungen einsetzen, um diese Freiheit zu garantieren. Der Nationalismus und der Liberalismus wurden aus demselben Grundstoff geformt. Nationen sind Kollektive, und der Liberalismus bezieht sich auf Individuen; liberale Nationen sind Ansammlungen von Individuen, deren Rechte als Bürger von Nationen garantiert werden.“ Und keine Nation sei so passend wie die amerikanische, die kein Nationalstaat, sondern genau genommen „eine Staatsnation, eine äußerst seltene Angelegenheit“ sei.
In diesem klaren, gelegentlich grundkurshaften Stil ist der gesamte Text gehalten, der sich mit seinen zehn übersichtlichen Kapiteln auf 150 Seiten gut in einem intensiven Rutsch bewältigen lässt. Lepore liefert einen Schnellritt durch die bewegte Geistesgeschichte liberaler Staatstheorie und skizziert anhand verschiedener Beispiele, wie stark die Nationwerdung der USA von Anfang an durch Differenz, Konflikt und Auseinandersetzung bestimmt war. Jene Eigenschaft, die vielen Beobachtern und auch liberalen Amerikanern selbst als Zeichen einer fundamentalen nationalen Dysfunktionalität gilt – die extremen juristischen, politischen und rhetorischen Konflikte um ganz elementare Verfassungsfragen – sieht sie als schützenswerten und außergewöhnlichen Kern Amerikas: „Die Nation ist der Kampf“, schreibt sie gleich an zwei Stellen.
Dieser Kampf drehte sich von früh an um die Frage, wer wirklich dazugehörte und wer nicht. Eine Vielzahl von verheerenden Niederlagen erlebten dabei nicht nur die schwarzen Amerikaner, sondern auch die Angehörigen der indigenen Stämme. Eine solche Niederlage war der erniedrigende Dawes Act von 1887, der indigenen Amerikanern die Staatsbürgerschaft bewilligte, wenn sie sich von ihrem Stamm trennten. Zuzüglich erhielten sie ein Stück Land und ein symbolisches Abschiedsgeschenk – Pfeil und Bogen für die Männer, eine Handarbeitstasche für die Frauen. Lepore nutzt paradoxerweise dieses Gesetz, um zu argumentieren, dass in jedem elenden Akt der US-Machthaber auch ein edler Funke des Widerstands wohnt: „Segregation, Exklusion und die mit dem Dawes Act verbundene Staatsbürgerschaft als Gegenleistung verrieten den Geist, die liberalen Versprechen und die verfassungsrechtlichen Garantien des 14. und 15. Zusatzartikels. Aber der Kampf, mit dem die Nation an diesen Versprechen gemessen wurde, sollte eine liberale Tradition fortführen, eine Tradition, die bürgerschaftliche Ideale wertschätzte und Forderungen für die Nation erhob.“
Das ist etwas hölzern ins Deutsche übertragen, und man muss sich intellektuell und politisch schon ein wenig verrenken, um Lepore zu folgen. Doch gelangt man, bei allen Widersprüchen, genau an die süße Stelle zwischen ziemlich genial und völlig absurd. Anders gesagt, da, wo es richtig interessant wird. Was auch nur eine Beschreibung für dieses Amerika ist.
MEREDITH HAAF
Manche Widersprüche führen
an die süße Stelle zwischen
ziemlich genial und völlig absurd
Bürgerwut mit Symbolgehalt: Demonstration gegen die Wahl von Donald Trump als US-Präsident im November 2016 in Oakland, Kalifornien.
Foto: Josh Edelson / AFP
Jill Lepore:
Dieses Amerika.
Manifest für eine bessere Nation. Aus dem Englischen von Werner Roller. Verlag C.H. Beck,
München, 2020.
158 Seiten. 14,95 Euro.
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
"In "Dieses Amerika. Manifest für eine bessere Nation" ruft (Jill Lepore) Sprecher der Anti-Sklaverei-Bewegung, Aktivistinnen der Frauenemanzipation und Führer der indigenen Stämme Amerikas als Kronzeugen an für ihre These, dass die Nation sehr wohl ein passendes Gefäß für einen echten, egalitären Liberalismus ist."
Süddeutsche Zeitung, Meredith Haaf
"Eine ebenso erhellende wie ermutigende Kurzfassung: Das historische Pendel schwingt immer auch wieder zurück."
Neue Zürcher Zeitung, Kathrin Meier-Rust
"Eine der wichtigen amerikanischen Denkerinnen unserer Zeit."
Bayern 2, Niels Beintker
"Eines der besten Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe."
Bill Clinton
"Jill Lepore ist der seltene Fall einer Doppelbegabung zwischen Akademie und Journalismus."
Tobias Rüther, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
Süddeutsche Zeitung, Meredith Haaf
"Eine ebenso erhellende wie ermutigende Kurzfassung: Das historische Pendel schwingt immer auch wieder zurück."
Neue Zürcher Zeitung, Kathrin Meier-Rust
"Eine der wichtigen amerikanischen Denkerinnen unserer Zeit."
Bayern 2, Niels Beintker
"Eines der besten Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe."
Bill Clinton
"Jill Lepore ist der seltene Fall einer Doppelbegabung zwischen Akademie und Journalismus."
Tobias Rüther, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung