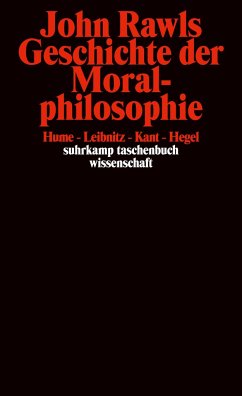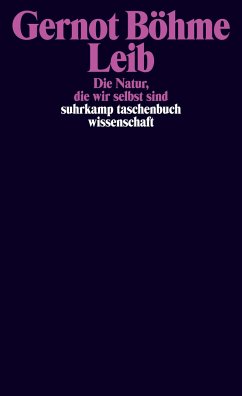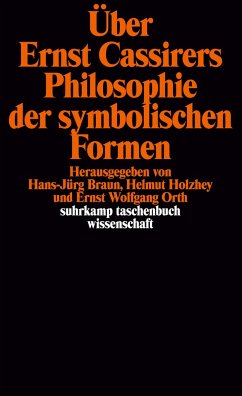Diesseits der Hermeneutik
Die Produktion von Präsenz
Übersetzung: Schulte, Joachim
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
16,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Daß die Geisteswissenschaften systematisch blind sind gegenüber jenen Schichten kultureller Welten, die nicht zur Dimension von Sinn und Bedeutung gehören und durch Interpretation zu erschließen sind, macht den Ausgangspunkt und die polemische Spitze dieses Buches aus. Was der Hermeneutik entgeht, sind Phänomene der Präsenz: »Dinge der Welt« setzen zu können. In diesem Sinn werden philosophische Begriffe entworfen und diskutiert, die über eine Rückwendung zu Phänomenen der Präsenz unser Verhältnis zur ästhetischen Erfahrung und zum Lernen neu bestimmen sollen und in einer Alltag...
Daß die Geisteswissenschaften systematisch blind sind gegenüber jenen Schichten kultureller Welten, die nicht zur Dimension von Sinn und Bedeutung gehören und durch Interpretation zu erschließen sind, macht den Ausgangspunkt und die polemische Spitze dieses Buches aus. Was der Hermeneutik entgeht, sind Phänomene der Präsenz: »Dinge der Welt« setzen zu können. In diesem Sinn werden philosophische Begriffe entworfen und diskutiert, die über eine Rückwendung zu Phänomenen der Präsenz unser Verhältnis zur ästhetischen Erfahrung und zum Lernen neu bestimmen sollen und in einer Alltagswelt, die Jean-François Lyotard einmal als im Status »allgemeiner Mobilmachung« befindlich beschrieben hat, vielleicht dem Wunsch nach Momenten der Gelassenheit Raum schaffen.