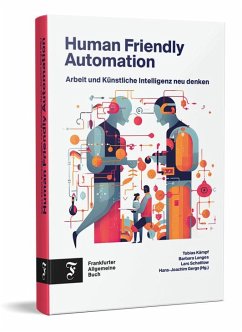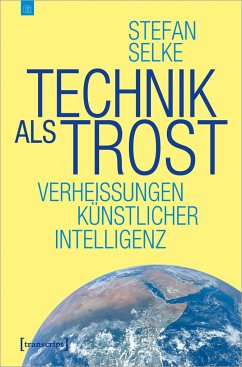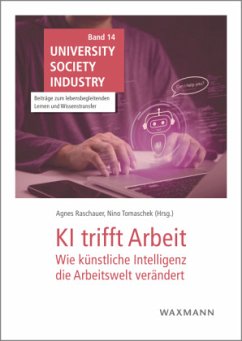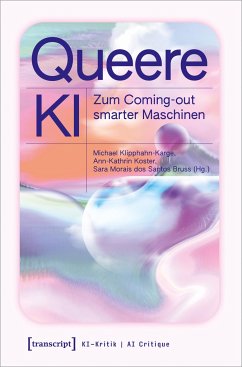Digitalisierung und die Zukunft der Demokratie
Beiträge aus der Technikfolgenabschätzung
Herausgegeben: Bogner, Alexander; Decker, Michael; Nentwich, Michael; Scherz, Constanze

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Demokratie steht unter Druck. Nicht nur populistische und autoritäre Bewegungen tragen dazu bei, sondern auch Digitalisierung, Internet und soziale Medien. Dieser Band präsentiert Antworten auf Fragen, die uns alle bewegen: Wie soll man den Herausforderungen, die durch Hass und Deepfakes, durch Polarisierung und Plattform-Giganten entstehen, begegnen? Die Autorinnen und Autoren kommen aus ganz unterschiedlichen Fächern, von der Technikfolgenabschätzung und Wissenschaftsforschung bis hin zu Philosophie, Politik- und Rechtswissenschaft. Diese interdisziplinäre Perspektive macht eine Besonde...
Demokratie steht unter Druck. Nicht nur populistische und autoritäre Bewegungen tragen dazu bei, sondern auch Digitalisierung, Internet und soziale Medien. Dieser Band präsentiert Antworten auf Fragen, die uns alle bewegen: Wie soll man den Herausforderungen, die durch Hass und Deepfakes, durch Polarisierung und Plattform-Giganten entstehen, begegnen? Die Autorinnen und Autoren kommen aus ganz unterschiedlichen Fächern, von der Technikfolgenabschätzung und Wissenschaftsforschung bis hin zu Philosophie, Politik- und Rechtswissenschaft. Diese interdisziplinäre Perspektive macht eine Besonderheit dieses Bandes aus.Mit Beiträgen vonSusanne Benöhr-Laqueur, Franziska Bereuter, Alexander Bogner, Stefan Böschen, Kerstin Cuhls, Michael Decker, Gerhard Embacher-Köhle, Gerda Falkner, Philipp Frey, Florian Hoffmann, Philip N. Howard, Brigitte Huber, Wilfried Jäger, Christoph Konrath, Jaro Krieger-Lamina, Moritz Leuenberger, Marc Mölders, Michael Nentwich, Julian Nida-Rümelin, Alexander Orlowski, Maria Pawelec, Florian Saurwein, Constanze Scherz, Christoph Schneider, Ingrid Schneider, Jan-Felix Schrape, Ulrich Smeddinck, Charlotte Spencer-Smith, Stefan Strauß, Dana Wasserbacher, Matthias Weber und Tamara Wilde.