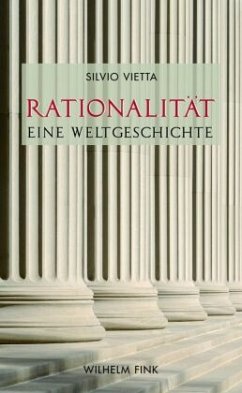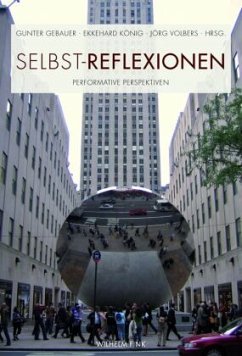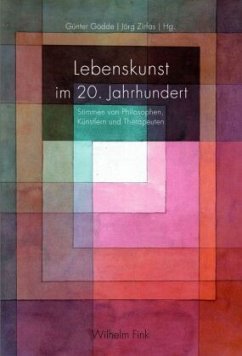Dimensionen und Grenzen der Begriffsgeschichte
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
56,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Entstanden in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts aus der historischen Semantik und als Nebenschauplatz einer programmatisch orientierten Untersuchungs- und Reflexionskultur hat sich die Begriffsgeschichte in den epistemologischen Bedingungen der siebziger und achtziger Jahre beinahe unbemerkt zum dominanten Paradigma der Geisteswissenschaften in Deutschland entwickelt. Unter der Dominanz der Hermeneutik und des neo-historischen Stils liess sich sogar - mindestens im Stil einer provozierenden Geste - der maximalistische Anspruch vertreten, dass Begriffsgeschichte deckungsgleich sei mit jener ...
Entstanden in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts aus der historischen Semantik und als Nebenschauplatz einer programmatisch orientierten Untersuchungs- und Reflexionskultur hat sich die Begriffsgeschichte in den epistemologischen Bedingungen der siebziger und achtziger Jahre beinahe unbemerkt zum dominanten Paradigma der Geisteswissenschaften in Deutschland entwickelt. Unter der Dominanz der Hermeneutik und des neo-historischen Stils liess sich sogar - mindestens im Stil einer provozierenden Geste - der maximalistische Anspruch vertreten, dass Begriffsgeschichte deckungsgleich sei mit jener historischen Arbeit schlechthin, welche nicht unter den Verdacht philosophischer Naivität fiele.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.