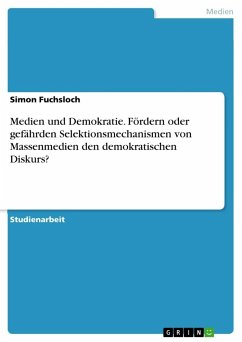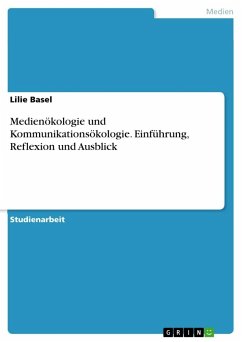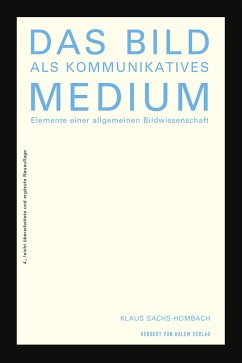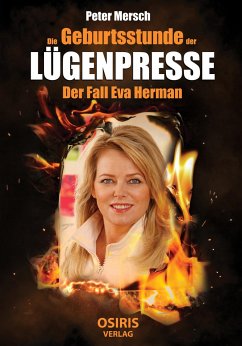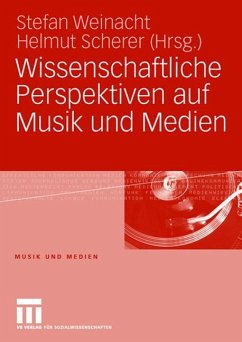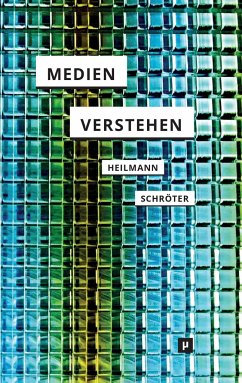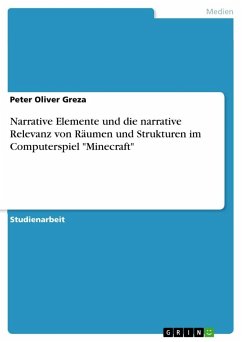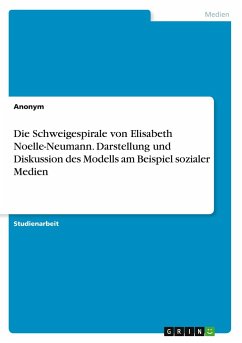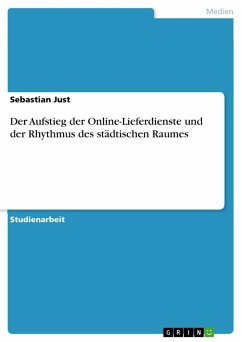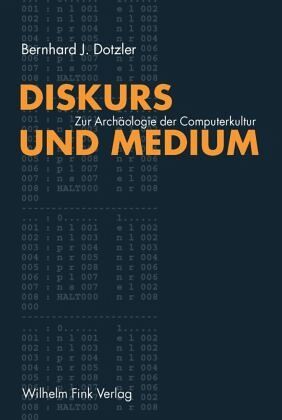
Diskurs und Medium I
Zur Archäologie der Computerkultur
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
56,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Es geht um Technik und Medien, Medien und Wissen, Wissen und Technik - und deren wechselseitigen Zusammenhang, der sich zeigt, wenn man beide Seiten, Diskurs und Medium, als verkörpertes Wissen begreift. Dass digitale Medientechnik die Gegenwart und Zukunft beherrscht, ist unumstritten. Wie aber sieht dadurch die Vergangenheit aus? Diskurs und Medium perspektiviert Computer als Mediengeschichte wie Mediengeschichte von der Geschichte des Computers her. 'In den letzten Jahren haben es einige Bücher über verwandte Themen zu Beststellern gebracht, beispielsweise Gödel, Escher, Bach von Dougla...
Es geht um Technik und Medien, Medien und Wissen, Wissen und Technik - und deren wechselseitigen Zusammenhang, der sich zeigt, wenn man beide Seiten, Diskurs und Medium, als verkörpertes Wissen begreift. Dass digitale Medientechnik die Gegenwart und Zukunft beherrscht, ist unumstritten. Wie aber sieht dadurch die Vergangenheit aus? Diskurs und Medium perspektiviert Computer als Mediengeschichte wie Mediengeschichte von der Geschichte des Computers her. 'In den letzten Jahren haben es einige Bücher über verwandte Themen zu Beststellern gebracht, beispielsweise Gödel, Escher, Bach von Douglas R. Hofstadter und Computerdenken von Roger Penrose [.] und so reich an Anregungen wie diese Bücher ist Dotzlers Werk allemal.' Herbert W. Franke in Spektrum der Wissenschaft
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.