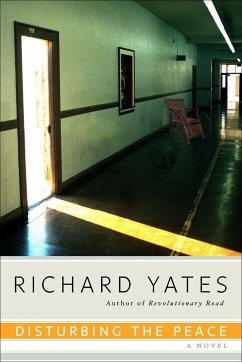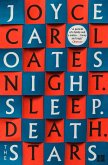Hailed as America s finest realistic novelist by the Boston Globe, Richard Yates, author of Revolutionary Road, garnered rare critical acclaim for his bracing, unsentimental portraits of middle-class American life. Disturbing the Peace is no exception. Haunting, troubling, and mesmerizing, it shines a brilliant, unwavering light into the darkest recesses of a man s psyche.
To all appearances, John Wilder has all the trappings of success, circa 1960: a promising career in advertising, a loving family, a beautiful apartment, even a country home. John s evenings are spent with associates at quiet Manhattan lounges and his weekends with friends at glittering cocktail parties. But something deep within this seemingly perfect life has long since gone wrong. Something has disturbed John s fragile peace, and he can no longer find solace in fleeting affairs or alcohol. The anger, the drinking, and the recklessness are building to a crescendo and they re about to take down John s career and his family. What happens next will send John on a long, strange journey at once tragic and inevitable.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Richard Yates ist die wichtigste Wiederentdeckung der amerikanischen Literatur: Mit seinem autobiographisch eingeschwärzten Trinker-Drama "Ruhestörung" liegt ein weiteres Hauptwerk erstmals auf Deutsch vor.
Vorgeplänkel gibt es bei diesem Autor nicht. Es ist, als würde eine Faust aus dem Buch kommen und den Leser hineinziehen: "Im Spätsommer 1960 begann für Janice Wilder alles schiefzugehen. Und das Schlimmste daran war, sagte sie später immer wieder, das Schreckliche daran war, dass es aus heiterem Himmel zu geschehen schien."
Was ist geschehen? John Wilder war eine Woche auf "Geschäftsreise". Er hat durchgesoffen, kaum geschlafen und mit seinem Leben gehadert. Jetzt sitzt er am Flughafen La Guardia in einer Kneipe und trinkt weiter. Von dort ruft er seine Frau an: Er könne nicht nach Hause kommen. Aber warum denn nicht, Schatz? Weil er Angst habe, dass er sie dann umbringen würde, sie und den Jungen. Und weil er eine kleine, schmuddelige Affäre hatte, mit der PR-Frau aus einer Whisky-Brennerei. Nach "heiterem Himmel" klingt das alles nicht.
Auf Rat eines Freundes lässt Wilder sich ins psychiatrische Krankenhaus "Bellevue" einweisen. Er landet auf der geschlossenen Abteilung für gewalttätige Männer; es wird ein Horrortrip. Denn gerade beginnt das Labour-Day-Wochenende, und alle Ärzte haben frei. Bis Wilder endlich untersucht wird, vergeht fast eine Woche - Zeit für fünfzig Seiten Grenzerfahrungen unter Süchtigen, Verwirrten, "Clowns in Zwangsjacken". Dieser Roman ist eine Tragödie, die bereits sehr abschüssig mit dem vierten Akt einsetzt.
Als Richard Yates 1992 starb, war sein Werk fast vergessen. Inzwischen zählt er zu den großen Autoren des zwanzigsten Jahrhunderts. Auch hierzulande werden Bücher wie "Easter Parade", der grandiose Roman zweier Schwestern, als Darstellungen des amerikanischen Durchschnittslebens gerühmt. "Revolutionary Road" aus dem Jahr 1961, eine fulminante Demontage der Vorstadtidylle, ist inzwischen durch eine mäßige Verfilmung mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio breitenwirksam ins Gespräch gekommen.
Unzufrieden sind sie alle, die Figuren dieses Schriftstellers. Sie gleichen ihr Leben ab mit den Glücksschablonen von Hollywood und kommen zu keinem guten Ergebnis; die Wirklichkeit hinkt ihren Träumen abgeschlagen hinterher. Zum Mythos Yates gehört die Alkoholkrankheit. Zu viel getrunken wird in allen seinen Büchern. Heute liest man solche Passagen, als würde in Wagners "Ring" das Todesmotiv erklingen. Deshalb besitzt heute auch Yates' dritter Roman "Ruhestörung" eine ganz andere Wucht als 1975, als man sich über vermeintliche Konstruktionsschwächen und vor allem die unsympathische Hauptfigur mokierte.
Tatsächlich muss man lange suchen, um einen ähnlich unangenehmen und gerade deshalb auch wieder faszinierenden "Helden" zu finden. Wilder (der Name ist Programm) hat diese kaum zu kontrollierenden Impulse der Aggression. Wilder gehört nicht zu jenen überlebensgroßen Heroen des Suffs (wie Malcolm Lowrys Konsul Geoffrey Firmin), deren Kaputtheit mit einem Mehrwert an Lebensphilosophie einhergeht und ins Metaphysische reicht. Er ist nur ein Angestellter, in dem die Lebenswut kocht. Seine Schwächen schmerzen ihn wie Wunden: die Kleinwüchsigkeit, die lächerliche Unfähigkeit beim Schwimmen oder die leichte Legasthenie, die ihm das Lesen verleidet hat. Aus Gründen der Kompensation hat er eine Passion für den Film entwickelt; er hat alles gesehen, er kennt sich aus, er wäre am liebsten Filmproduzent geworden. Wie zum Hohn spannt Yates diesen Mann mit einer Ehefrau von patenter Durchschnittlichkeit zusammen.
Nach der Rückkehr aus "Bellevue" besucht er Treffen der Anonymen Alkoholiker - aber er ist nicht demütig genug, um sich deren Beichtpraxis und euphorischer Zerknirschung anzuschließen. Auch die Sitzungen beim Psychologen nehmen einen ungünstigen Verlauf: Immer wenn Wilder an die Schmerzpunkte seiner Biographie kommt, tönt es zuverlässig vom Therapeuten: "Mr. Wilder, ich fürchte, unsere Zeit ist jetzt um." Dieses "fürchte" ist schon sehr gut. Natürlich bekommt Wilder da wieder einen seiner Ausbrüche von "Feindseligkeit". Dabei ist er ein Sohn des von Anstand und Ambition geprägten Mittelstands. Die Eltern haben es in monomaner Konzentration auf ihre Geschäftsidee (feine Pralinen) zu etwas gebracht: "Man kann verdammt noch mal keinen amerikanischen Supermarkt mehr betreten, ohne mit einem dieser großkotzigen Drehgestelle zusammenzustoßen: ,Marjorie Wilders Pralinen'", schimpft der verlorene Sohn. In einer atemberaubenden Szene wird er tatsächlich mit einem der familiären Drehgestelle kollidieren.
Im Mittelteil des Romans kommt unverhofft eine Aufwärtsbewegung in Gang. Eigentlich ist Wilder ja auch alles andere als ein aussichtsloser Fall; in seiner Werbeagentur gehört er zu den Besten. Für ihn aber ist das alles eine Nummer zu klein. Und plötzlich scheinen seine alten Filmträume wahr zu werden. Seine neue Geliebte Pamela teilt die Kinoleidenschaft mit ihm und bestärkt ihn in der Idee, über seine Bellevue-Erfahrung einen Kunstfilm zu drehen. Pamela hat Kontakte; der Weg führt von Filmstudentenkreisen bis nach Hollywood. Es scheint die große Wende zu sein. Aber da wir den vierten Akt schon zu Anfang hatten, kommt die Katastrophe umso rapider. Das Filmprojekt stagniert, im Gegensatz zu Wilders eskalierendem Alkohol- und Tablettenmissbrauch.
Genau werden die Stadien des Verfalls beschrieben, etwa der Ekel vor dem Essen, als Wilder in einem Restaurant vor einem obszön großen Steak und einer gewaltigen Ofenkartoffel sitzt und schon den ersten Bissen nicht herunterbekommt. Auch wenn der Roman in der dritten Person erzählt ist, hält er sich zumeist doch an Wilders Wahrnehmung. So werden im außerordentlich starken Schlussdrittel Desorientierung und Filmriss zu narrativen Prinzipien. Der Leser erwacht mit Wilder nach einem Zusammenbruch an ungewohntem Ort: "Er war nackt und lag um sich schlagend in einem Krankenhausbett, drei oder vier weiß gewandete Menschen beugten sich über ihn, hielten ihn fest und versuchten, ihm etwas in den Arm zu stechen. Eine von ihnen war eine junge Krankenschwester, deren linke Brust vor seinem Auge hing. Er biss hinein und sie sagte ,Au', so leise, als würde ihr die Schwesternausbildung absolute Zurückhaltung gebieten." Lässt sich Wilders latenter Haifisch-Charakter kurioser verdeutlichen?
Der feste Boden entgleitet; die Realität wird löchrig. Die paranoiden Schübe, der Durchbruch des schizophrenen Wahns, die Erlöserphantasien - all das wird nicht behauptet, sondern vergegenwärtigt. Yates beherrscht die Kunst, Lieblosigkeit und scheiternde Kommunikation im Umgang nah vertrauter Menschen darzustellen, in einem unaufgeregten, präzisen Erzählton, dessen trockene Pointen die Übersetzung von Anette Grube gut vermittelt. Die meisterhafte Lakonik macht sich in vielen kleinen Szenen geltend, etwa bei den Auftritten von Wilders Sohn Tommy, der um seine Kindheit nicht zu beneiden ist. Außer "Okay, Dad" hören wir wenig von ihm - aber das reicht, um vieles anzudeuten.
Ebenso unaufdringlich wie markant ist der Roman eingebettet in den historischen Hintergrund, die sechziger Jahre. Mit ungewohnter Empathie reagiert Wilder auf die Nachricht von der Ermordung Kennedys, später wird er sich gar mit dem Attentäter verwechseln.
Der literarische Realismus, den dieser Autor seit "Revolutionary Road" unbeirrt verfolgte, galt um 1970 als überholt. Yates verachtete seinerseits die angesagten Bücher der Postmodernen: schwerverdauliches Zeug, voller intellektueller Puzzlespiele und Oberseminarwitzigkeit; emotional leer, Literatur, die nicht "gefühlt" ist. Trotzdem hat Yates in "Ruhestörung" mit dem Filmmotiv selbst einige metafiktionale Volten und Spiegelfunktionen eingebaut - was in diesem Fall die bittere existentielle Ironie aber nur noch steigert: Wilders Leben wird zur tragischen Farce. Er lebt nach, was ein rasch angeheuerter Drehbuchautor aus dem Handgelenk als weiteren Handlungsverlauf für sein autobiographisches "Bellevue"-Projekt skizziert hatte. Sogar die Heilanstalt, die der Hollywood-Schreiber fürs Finale vorgesehen hatte, ist dieselbe, in der Wilder am Ende als Dauerpatient hinlebt. Der Drehbuchentwurf war vom Produzenten abgelehnt worden: zu klischeehaft. Die Realität schert sich nicht um solche Geschmackseinwände.
WOLFGANG SCHNEIDER
Richard Yates: "Ruhestörung". Roman. Aus dem Englischen von Anette Grube. DVA, München 2010, 315 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main