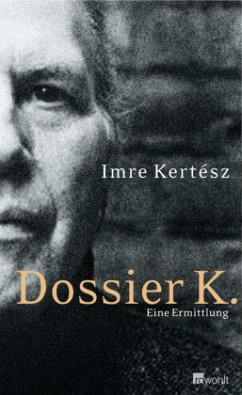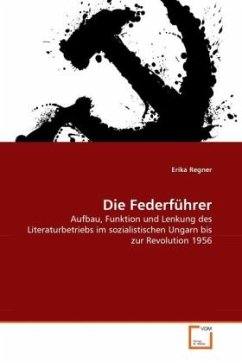Imre Kertész´ Autobiographie - der Schlüssel zu seinem Lebenswerk
Imre Kertész gilt heute unangefochten als einer der großen künstlerischen und denkerischen Deuter der Welt nach Auschwitz. Sein Werk wird als autobiographisch gelesen, doch ist es notwendig komponiert durch die Gesetze von Stil und Fiktion. Wie steht es mit seinem Leben in Verbindung? Unter welchen Umständen ist es entstanden?
Mit "Dossier K." legt Kertész nunmehr eine Art Autobiographie vor, eine skrupulöse (Selbst-)Befragung im Dienste persönlicher und historischer Wahrhaftigkeit. Sie erschließt nicht nur die intimen Zusammenhänge von Leben und Werk mitsamt ihren poetologischen Voraussetzungen, sondern ist, im besten Sinne des Wortes, Zeitzeugenschaft - von Kertész´ familiären Wurzeln in der versunkenen jüdischen Kultur Vorkriegsungarns über die Schrecken des Nationalsozialismus bis hin zu einem politisch bewussten Leben zwischen stalinistischen Schauprozessen, Aufstand und Diktatur.
Imre Kertész gilt heute unangefochten als einer der großen künstlerischen und denkerischen Deuter der Welt nach Auschwitz. Sein Werk wird als autobiographisch gelesen, doch ist es notwendig komponiert durch die Gesetze von Stil und Fiktion. Wie steht es mit seinem Leben in Verbindung? Unter welchen Umständen ist es entstanden?
Mit "Dossier K." legt Kertész nunmehr eine Art Autobiographie vor, eine skrupulöse (Selbst-)Befragung im Dienste persönlicher und historischer Wahrhaftigkeit. Sie erschließt nicht nur die intimen Zusammenhänge von Leben und Werk mitsamt ihren poetologischen Voraussetzungen, sondern ist, im besten Sinne des Wortes, Zeitzeugenschaft - von Kertész´ familiären Wurzeln in der versunkenen jüdischen Kultur Vorkriegsungarns über die Schrecken des Nationalsozialismus bis hin zu einem politisch bewussten Leben zwischen stalinistischen Schauprozessen, Aufstand und Diktatur.

Diamanten im Bergwerk der Erinnerung: Imre Kertész erzählt sein Leben als fiktives Gespräch / Von Andreas Kilb
Den Anstoß zu diesem Buch, erzählt Imre Kertész in seiner Vorbemerkung zu "Dossier K.", hätten die Tonbandabschriften eines Interviews gegeben, das ein befreundeter Lektor mit ihm in den Jahren 2003 und 2004 geführt habe. "Als ich die ersten Sätze gelesen hatte, legte ich den Manuskriptpacken beiseite und öffnete, sozusagen mit einer unwillkürlichen Bewegung, den Deckel meines Computers..." Das klingt zu lässig, zu beiläufig, um wahr zu sein, zumal bei diesem Autor.
Und wenn man die dann folgenden, akribisch durchkomponierten 230 Seiten gelesen hat, klingt es noch unwahrscheinlicher. Dennoch sollte man das kleine Vorwort nicht einfach beiseite schieben. Denn es enthält eine genaue Anleitung, wie dieses Buch zu lesen ist. Das Gespräch mit dem Freund hat es wirklich gegeben, auch wenn Kertész es anschließend neu erfunden hat - so, wie es das Leben des Imre Kertész wirklich gab und gibt, auch wenn es in seinen Büchern zum Gegenstand seiner Imagination wird. Daß der "Roman eines Schicksallosen" von 1973, mit dem sich Kertész in die Weltliteratur eingeschrieben hat, autobiographische Züge hat, konnte keinem Leser entgehen. Daß diese Geschichte vom Überleben in Auschwitz und Buchenwald aber zugleich ein Kunstprodukt ist, literarisch gestaltete Erfahrung, darauf hat niemand öfter und dringlicher hingewiesen als Kertész selbst.
In "Dossier K." erzählt er dazu eine Geschichte, in der die "unwirkliche Wirklichkeit" des Romans mit Händen zu greifen ist. Ende der neunziger Jahre habe er, Kertész, den Leiter der Gedenkstätte Buchenwald kennengelernt und mit ihm zusammen nach Spuren jenes "Saal sechs" im Krankenrevier gesucht, in dem der fünfzehnjährige Kertész nach seinem Zusammenbruch im Konzentrationslager gepflegt wurde. "Doch vergeblich durchforschten wir Akten, Fakten, das gesamte zur Verfügung stehende Material." Stattdessen fanden sie einen Eintrag im Häftlingsregister, nach dem "Kertész, Imre, ungarischer Jude, Häftling Nummer 64921" am 18. Februar 1945 gestorben sei. Hilfreiche Hände also hatten den Jungen aus der Liste der Lebenden gestrichen, um ihn vor der Ermordung zu bewahren.
Doch die Geschichte geht weiter. Im Winter 2002, als Kertész Ehrengast in Stockholm ist, bekommt er einen Anruf aus Australien. Am Apparat ist ein Mann namens Kucharski, der den Roman des Nobelpreisträgers gelesen hat und darin auf sich selbst gestoßen ist: Er hat in jenem nicht mehr nachweisbaren "Steppdecken-Revier" von Buchenwald im Bett über Kertész gelegen. "Das Problem war nur, daß Kucharski nur Englisch - oder Polnisch - sprach und wir einander so kaum verstanden, da ich Polnisch überhaupt nicht kann und Englisch auch nur sehr fragmentarisch." Dem Schriftsteller bleibt nur die Erinnerung an "eine fast transzendente Nachricht", eine Stimme aus der Vergangenheit, deren Echo sich im Rauschen des Telefons verliert.
Ein Leben, das solche Anekdoten hervorbringt, läßt sich nicht in einer konventionellen Autobiographie spiegeln. Es ist das Gegenteil eines Bildungsromans; seine bestimmenden Züge sind nicht organische Entwicklung und Kontinuität, sondern Bruch und Schock. Deshalb beginnt "Dossier K.", dieses fiktive Zwiegespräch, das zugleich ein realer Dialog zwischen Ich und Nicht-Ich ist, auch nicht mit einer Geburts- oder Kindheitsszene, sondern mit einem Augenblick der Panik. Der Autor, vierzehn Jahre alt, steht im Hof der Budapester Gendarmeriekaserne vor dem Lauf eines feuerbereiten Maschinengewehrs. So hat er es knapp vierzig Jahre später in seinem Roman "Fiasko" beschrieben. Warum aber, fragt ihn nun sein Gegenüber, "warum kommt diese Episode im ,Roman eines Schicksallosen' nicht vor?"
Man sieht, wie raffiniert der doppelte Faden dieses Buches geknüpft ist, wie er Leben und Werk, ästhetische und biographische Existenz miteinander verschlingt. "Soll ich jetzt etwa über all das reden, worüber ich nie reden wollte?", fragt das Autoren-Ich. Und der Interviewer, hinter dem sich, wie wir wissen, ebenfalls der Autor verbirgt, fragt zurück: "Warum hast du dann darüber geschrieben?" Es geht ums Ganze in "Dossier K.": um die Kindheit, das Leben unter der Diktatur, aber auch das eigene Schreiben, seine Wahrhaftigkeit, seinen Weltgehalt; um das, was man seit Heidegger mit dem Kunstwort "Authentizität" bezeichnet.
An einer der berührendsten Stellen des Buches liest der Interviewer dem Interviewten eine Passage aus Kertész' Reiseaufzeichnungen "Ich - ein anderer" von 1997 vor, in der ein Moment intensiven Glücksgefühls am Fuß des Montblanc beschrieben wird: Gebirgsluft, Roséwein, zu zweit genossene Freiheit. Der Autor aber reagiert kühl: "Ja, ja. Ein schöner Abend, exquisite Probleme ..." Wenn man nicht wüßte, daß Kertész beides geschrieben hat, die Frage und die Antwort, könnte man ihn für einen Zyniker halten. Erst in der Doppelperspektive, die er nun auf sich selbst wirft, offenbart sich die ganze Persönlichkeit dieses Autors, sein immenses Glücksverlangen und seine ebenso starke Glücksabwehr, das verlorene Weltvertrauen, das er, wie er mit einem Seitenblick auf Jean Améry erklärt, nach Auschwitz nicht mehr zurückgewonnen hat. "Ein solcher Mensch kann in dem anderen nie mehr den Mitmenschen, sondern immer nur den Gegenmenschen sehen."
Und doch ist "Dossier K.", in dem sich Kertész als sein eigener Gegenmensch gegenübertritt, auch ein Versuch, den Anschluß an die Menschheit wiederzufinden, sich selbst als Individuum, als Subjekt der eigenen Geschichte zu bestimmen - in der "Schicksallosigkeit", zu der erst die faschistische, dann die kommunistische Tyrannei den Schriftsteller K. verdammt hat, die Umrisse eines Schicksals zu entdecken.
Dieses Schicksal beginnt mit der Mutter. Sie ist nach dem vierzehnjährigen Knaben Imre die zweite Person, die in "Dossier K." aus der Vergangenheit aufsteigt, und ihr Porträt leuchtet stärker als jedes andere in diesem Buch. Als ihr Sohn im Sommer 1944 verschwindet, läuft sie mit ihrem gelben Stern auf der Brust ins Kriegsministerium und fordert ihn zurück. Nach dem Krieg, den sie in einem Gettoversteck überlebt, heiratet sie einen Ingenieur und führt ein großbürgerlich elegantes Leben mitten im realen Sozialismus. Seine Mutter, sagt Kertész, habe ihr Weltvertrauen niemals verloren: Sie sei "farbenblind" gewesen gegenüber allem, was sie nicht unmittelbar betraf. Man spürt, wie er sie um diese Farbenblindheit beneidet - und ihr zugleich deswegen zürnt, wie nur ein Sohn seiner Mutter zürnen kann.
Anders der Vater, die dritte Hauptfigur dieses Buchs. In "Kaddisch für ein nicht geborenes Kind" hat ihn Kertész mit Verachtung gezeichnet. Hier gedenkt er seiner mit einer Liebe, die noch kleinste Details zum Leben erweckt: den blauen Topf, aus dem der Vater Gänseschmalz nascht; das Knoblauchbrot, das er am Sonntag im Bett knuspert; sein bläulicher Bart, über den das Barbiermesser kratzt. Wie Sternschnuppen glühen solche Gedächtnisscherben auf, doch es bleiben Scherben. "Siehst du, ein ganzes Leben langweilen uns Familiengeschichten, und wenn wir sie dann brauchen, wühlen wir plötzlich unwissend in der unbekannten Vergangenheit herum." Diese Suchbewegung hat einen doppelten Effekt: Sie verstört, und sie reißt mit. Sie reißt den Leser tief in jenes zwanzigste Jahrhundert hinein, in der das Ganze zum Teufel ging und Humanität nur in Bruchstücken überlebte, in einem Buch, einer Melodie, einem Stück Brot.
Kertész bewahrt sie mit jener Skepsis auf, die man von ihm gewohnt ist. Doch dann stellt er unvermittelt seinen Sucher scharf, und es entsteht ein Bild wie das seines Großvaters, eines verarmten Ladenbesitzers: "Beide Hände so in die Taschen seines grauen Sakkos gesteckt, daß die Daumen draußen blieben, drehte er sich wortlos in der Tür um und entschwand im Hauch seines eigenen Atems, wie ein Magier." Solche Sätze sind die Diamanten im Bergwerk der Erinnerung, und es gibt viele von ihnen in "Dossier K.".
Bevor er aber in die Schrecken des Jahrhunderts eintaucht, bevor er lernt, in Auschwitz um sein Leben und als Lustspielschreiber im Ungarn der Kádár-Zeit um sein Brot zu lügen, öffnet sich für Kertész das Reich der Bücher. Er hat es nie wieder verlassen. "O Labsal, o Trost meiner kranken Seele!" Das schreibt er über die "Hornblower"-Romane von C.S. Forester, und mit ebenso großer Wärme spricht er von Kant (dessen "Kritik der Urteilskraft" ihn "bestätigt und errettet" hat), von Camus, Valéry, Mann, Kafka und vielen Autoren seines Heimatlands.
"Dossier K.", diese Elegie eines schicksallosen Lebens, ist auch ein Hymnus auf die Literatur, in der die Schicksale aufgehoben sind. "Du verstößt dich aus einer eigenen Geschichte", wirft der Interviewer einmal dem Interviewten vor. Dieser entgegnet, "daß mein Platz nicht in der Geschichte, sondern am Schreibtisch ist". Beide haben recht. Der Beweis ist dieses Buch.
Imre Kertész: "Dossier K. Eine Ermittlung". Rowohlt Verlag Reinbek bei Hamburg 2006. 238 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Die für Imre Kertesz charakteristische "scharfe Logik" findet Christoph Schröder auch in seinem "Dossier K." wieder. Kertesz' Text sei im "Grenzgebiet von Erfindung und Selbstauskunft" angesiedelt, gleichzeitig eine Autobiografie und ein "Labyrinth aus Selbstverweisen, intertextuellen Anspielungen und Fiktion", das dem Autor auch als Schutz dient, wenn er sich zu eindeutig festlegen muss, berichtet der Rezensent. Die dialogische Gestalt des Textes verdankt sich der Tatsache, dass es auf Gesprächen des Autors mit seinem Verleger basiert. Dabei sei der Text trotz seines bisweilen sogar "recht launigen Tonfalls" keine leichte Lektüre, denn Kertesz' Kernfrage sei die nach der Möglichkeit und der Notwendigkeit des Weiterlebens nach der Erfahrung des Holocaust, stellt Schröder fest. Wenn er auch einige "Eitelkeiten" im Text aufspürt, schätzt er Kertesz' "Ermittlung in eigener Sache" doch auch wegen ihrer spannenden und spannungsvollen Einblicke in die Poetologie des Autors.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Dies ist das einzige meiner Bücher, das ich eher auf äußere Veranlassung als aus innerem Antrieb geschreiben habe: eine regelrechte Autobiographie." - Imre Kertesz
So universal ist Imre Kertész' Literatur, so undogmatisch und unaufgeregt, dass sie die Würde des Nobelpreises mittlerweile weit übersteigt. Neue Zürcher Zeitung