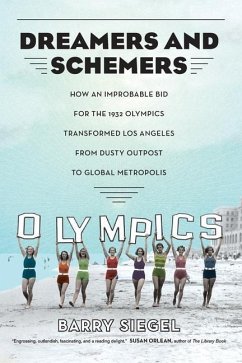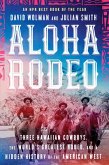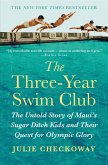"Dreamers and Schemers brings alive the rollicking era when Los Angeles came of age, even as the world plunged into war and the Great Depression. What a remarkable tale. This is masterful storytelling."--Gay Talese "Barry Siegel brilliantly evokes a complex drama: the misery of the Great Depression, a flood of desperate migrants coming into Southern California, relentlessly optimistic boosterism promoting the first summer Olympics on US soil in nearly thirty years--and an extraordinary, larger-than-life character at the center of the story."--Adam Hochschild, author of Lessons from a Dark Time and Other Essays "Dreamers and Schemers is engrossing, outlandish, fascinating, and a reading delight. It pulls the curtain back on a great piece of LA history--the 1932 Olympics--and manages to tell the entire story of the city's rise. A pleasure for anyone who loves a well-told tale."--Susan Orlean, author of The Library Book
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Zeit zu lesen: Erst die Spanische Grippe, dann die Große Depression - die Geschichte der Spiele von Los Angeles 1932, wie der Pulitzer-Preisträger Barry Siegel sie erzählt, ist auch ein Lob des olympischen Geistes in Krisenzeiten.
Von Christian Kamp
Es war eine der besten Ideen in der olympischen Geschichte, und sie wurde buchstäblich aus der Not geboren. Das Olympische Dorf, für Athleten bis heute so etwas wie das Herz jeder Spiele und ein Sehnsuchtsort, war vor 90 Jahren vor allem ein Mittel zum Zweck: ersonnen, um die Spiele von Los Angeles 1932 zu retten. In Zeiten der Großen Depression fürchteten die Organisatoren, sie könnten am Ende ziemlich allein dastehen angesichts der Kosten für eine Schiffs- und Bahnreise nach Kalifornien samt Übernachtungen, die für viele europäische Nationen unerschwinglich schienen. Eine Blamage drohte, schließlich hatte das aufstrebende Los Angeles, der "Great Gatsby unter den amerikanischen Städten", sich mit diesen Spielen neu erfinden wollen, wie Barry Siegel, langjähriger Reporter der "Los Angeles Times" und Pulitzer-Preisträger, in seinem im vergangenen Jahr erschienenen Buch "Dreamers and Schemers" beschreibt: die "Transformation von einem schmuddeligen Außenposten zur globalen Metropole", so heißt es im Untertitel. Heute kann man diese Geschichte um den umtriebigen und charismatischen Macher William May "Billy" Garland zuallererst als etwas anderes lesen: als Lob des olympischen Geistes in Zeiten schwerer Krisen und Verwerfungen. Mit dem Olympischen Dorf als Erbe für die Ewigkeit.
Die Spiele 1932, schreibt Siegel, hätten Garlands Vision erfüllt: den Amerikanern ein Leuchtfeuer der Hoffnung zu geben, ein "Beacon of Light" in dunklen Zeiten - was just jene Formel ist, die das Internationale Olympische Komitee (IOC) in diesem März verwendete, um das Festhalten an den Plänen für Tokio in diesem Sommer mit einem hübschen Bild zu schmücken (und das nun mit Blick auf 2021 immer noch tut). Es war, wie man da schon ahnen konnte und heute weiß, eine Illusion, die Zeit und das Virus sind darüber hinweggegangen. So, wie andere Krisen fast die Spiele von L.A. hinweggerissen hätten - wäre da nicht Garlands Spirit gewesen.
Als der erfolgreiche Grundstücksmakler und Strippenzieher Garland Ende 1918 die Herausgeber der fünf großen Tageszeitungen von Los Angeles in seinem Büro versammelt, ist die Große Depression zwar noch fern, aber am Ende des "Great War" lastet anderes auf der Seele - und der Wirtschaft - dieser bis dato selbstbewusst nach Höherem strebenden Stadt. Eine landesweite Quarantäne ist in Kraft, um der Spanischen Grippe Herr zu werden, allein in Kalifornien gibt es bereits 115 000 Tote. Schulen, Colleges, Kirchen, Theater und natürlich auch die Kinos sind geschlossen, Geschäfte weitgehend, der Tourismus liegt am Boden. In Garlands Büro, schreibt Siegel, liegt eine Idee in der Luft, noch nicht konkret ausformuliert, aber offenbar von großer Imaginationskraft: Was, wenn Los Angeles sich um die Olympischen Spiele bemühte?
Die Story, wie Garland sie tatsächlich nach L.A. holt, ist ein Pionierstück für sich. Im Juli 1920 schifft er mit seinen zwei Söhnen nach Europa ein - auf der SS Olympic -, um bei den Spielen in Antwerpen Kontakte zu knüpfen. Eine besondere Verbindung entsteht zu Baron Pierre de Coubertin, dem IOC-Präsidenten. Französische Aristokratie und amerikanischer Geldadel - das mögen verschiedene Welten sein, aber die Wellenlänge ist, auch wenn beide gerne taktische Spiele spielen werden, dieselbe. Als Garlands Faustpfand dienen neben dem Sprung in die neue Welt die Pläne für das riesige Coliseum, in dem später auch die Spiele 1984 stattfinden werden. Und auch wenn Garland lernen muss, sich in Geduld zu üben, zuerst sollen Paris (1924) und Amsterdam (1928) an der Reihe sein - bei der Session 1923 in Rom ist er am Ziel: Los Angeles erhält den Zuschlag für 1932.
Die andere, dramatischere Story ist die, wie L.A., wie Garland die Spiele wieder zu verlieren droht. Beim IOC ist seit 1925 der belgische Graf Henri de Baillet-Latour am Steuer, schlingernd in unsteter Weltlage, der Wille der europäischen Sportverbände, ein Abenteuer in der Neuen Welt einzugehen, ist geschwunden. In der Heimat wachsen die Zweifel und die Finanzierungsprobleme. Während 1928 in Amsterdam die 9. Sommerspiele laufen, wirken die von L.A. schon tot. Garland, mit Nachdruck und Charisma, haucht ihnen ein erstes Mal neues Leben ein, dann kommt das Jahr 1929, der New Yorker Börsencrash, die Große Depression - als sich das IOC 1930 in Berlin versammelt, geht es für L.A. um alles. Garland ist vorbereitet. Er hat nicht nur einen Werbefilm made in Hollywood im Gepäck, sondern auch ein Reisepaket, das die Olympia-Tour für einen europäischen Athleten knapp 500 Dollar kosten lassen würde, ein Viertel der ursprünglich veranschlagten 2000 - auch, weil ein eigenes Athletendorf entstehen soll, mit subventionierten Tarifen und nur 15 Fahrminuten vom Coliseum entfernt. Die Idee stammt von Zack Farmer, dem Generalsekretär des Organisationskomitees.
Es ist eine kühne, eine grandiose Idee, wie die olympische Geschichte zeigen wird, zunächst jedoch sind die Reaktionen alles andere als begeistert, das Wort "Kollektivismus" fällt, ein Kampfbegriff, Delegierte warnen vor offenen Rassenkonflikten, aber am Ende wird der Plan abgesegnet, L.A. ist weiter im Spiel.
Doch die wirtschaftliche Lage bleibt miserabel, auch in Los Angeles gehören die nach Präsident Herbert C. Hoover benannten "Hoovervilles" zum Stadtbild, Shantytowns der Ärmsten, im Schatten des Coliseums versorgen Suppenküchen die Bedürftigen. Es gibt Proteste gegen Olympia: "Groceries Not Games". In Europa verdüstert sich die politische Lage, und Coubertin, aus dem Ruhestand, mahnt Garland in einem Brief, dass ein Verschieben "unmöglich" sei - Olympia sei in Kalifornien zu feiern, "selbst wenn Krieg über Europa und dem östlichen Teil der Welt toben werde". Anfang 1932, fünf Monate vor der geplanten Eröffnung, hat noch kein einziges Land Garlands Einladung nach L.A. angenommen, nicht einmal für die Anreise der eigenen Athleten scheint Geld da zu sein, die Ticketverkäufe sind nicht der Rede wert. Avery Brundage, der Präsident des Amerikanischen Olympischen Komitees, prophezeit düster "Calamity", ein Unglück. Wieder braucht es Garlands persönlichen Einsatz, um die Zweifler zu überzeugen, er macht die Ausrichtung zu einer "Frage der Ehre".
Auf fast wundersame Weise - und mit Hilfe aus Hollywood - wendet sich das Blatt noch. Garland hat hoch gepokert, er hat einfach immer weiter seine Wunschbilder verkauft, in der Heimat wie in aller Welt und nicht zuletzt dem IOC, aber am Ende geht seine Strategie der Self-Fulfilling Prophecy auf. Garland und der große Gatsby, sie haben es der Welt gezeigt: Mitten in der Great Depression erlebt Los Angeles großartige Spiele, mit 1,75 Millionen Besuchern, einem Rekord, einem Gewinn von etwas mehr als einer Million Dollar, dem ersten in der olympischen Geschichte, mit etlichen Weltrekorden - und mit einem frischen Geist, der sich nicht nur im Olympischen Dorf zeigt, in dem die "New York Times" den "krönenden Touch" der Spiele sieht, Baron Coubertin später "das brillante Juwel" und "einen großen Triumph". Mehr als vorher prägen in L.A. auch Athletinnen das Bild, einige von ihnen, wie die Leichtathletin Babe Didrikson oder die Schwimmerin Helene Madison, werden zu Stars (im Dorf dürfen sie allerdings nicht wohnen, sie sind in einem noblen Hotel untergebracht). Und zum ersten Mal tritt mehr als eine Handvoll schwarze Athleten bei Olympia an, für Furore sorgen vor allem Eddie Tolan und Ralph Metcalfe, die das Rennen um die Sprint-Krone über 100 Meter unter sich ausmachen.
Die Athleten, sie betreten bei Siegel spät, aber nicht zu spät die Bühne. Und mit ihnen Geschichten, die viel über den olympischen Traum erzählen - und die Härten, unter denen er in jener Zeit erkämpft werden musste. Die von Glenn Cunningham etwa, der bei einem Brandunfall seinen Bruder und beinahe auch seine Beine verlor, in Los Angeles über 1500 Meter Vierter wird (und vier Jahre später in Berlin Silber gewinnt). Die der südafrikanischen Schwimmerin Jennie Makaal, deren Mutter, Witwe mit drei Kindern, ihr Haus verpfändet, um die Reise zu ermöglichen. Oder die des brasilianischen Teams, das seine Überfahrt mit Hilfe von 50 000 Säcken Kaffeebohnen finanziert, die während der Reise verkauft werden sollen, was erst mit Verspätung, aber gerade noch rechtzeitig gelingt.
"Nicht die Depression schwächte die Spiele der zehnten Olympiade, die Spiele der zehnten Olympiade milderten die Depression", schreibt die "Los Angeles Times" in einem Editorial. Für Billy Garland fordert sie "stürmischen Dank" ein.
Dass Los Angeles nach 1932 noch ein zweites Mal ein Segen für das IOC sein wird, 1984, als trotz des Boykotts fast des gesamten Ostblocks das Muster der kommerziell höchst erfolgreich vermarkteten (und für manchen auch: verkauften) Spiele geboren wird, spielt bei Siegel keine Rolle. Ebenso wenig der Blick noch weiter voraus, bis 2028, wenn L.A. mit seinem Coliseum zum dritten Mal Gastgeber sein wird. Eine solche Weitung der Perspektive hätte, zumal unter der neuen Lesart, noch einmal Gewinn versprochen. So endet das Buch, noch bevor man sich wirklich fragen kann, ob aus 1932 etwas für die heutige Krise zu lernen wäre, was Tokio vielleicht im kommenden Jahr der Welt geben kann, mit einem desillusionierenden Schluss.
Nach dem Licht kommt bei Siegel wieder das Dunkel, wirtschaftlich, politisch. Die weltweiten Spannungen wachsen, und auf 1932 folgt das wohl schwärzeste olympische Kapitel, Berlin 1936. Garland, seit 1922 IOC-Mitglied und von Siegel bislang trotz aller (eigenen) ökonomischen Interessen als vom olympischen Geist bewegt porträtiert, gibt nun keine gute Figur mehr ab. In der Frage der Startberechtigung jüdischer Athleten für das Nazi-Reich und eines möglichen amerikanischen Boykotts verhält er sich geradezu erschütternd naiv. In einem zustimmenden Brief an Brundage, der den Beschwichtigungen aus Deutschland glaubt, gebraucht Garland die Formel, dass "wir allein im Sport, nicht in der Politik sind" - was folgt, ist ein historisches Versagen.
Dass 1932 in Los Angeles die 550 Bungalows des Olympischen Dorfs mit dem Ende der Spiele abgebaut und ebenso wie das Interieur verkauft werden, mag fast noch moderner anmuten als die Idee des Dorfes selbst. Für Siegel ist es auch emblematisch für die große Illusion, die in diesen Spielen steckte. Der olympische Geist, so muss man das wohl heute wie damals lesen, ist zwar ein zauberhaftes, aber eben auch ein unstetes, ein flüchtiges Wesen.
Barry Siegel: Dreamers and Schemers: How an Improbable Bid for the 1932 Olympics Transformed Los Angeles from Dusty Outpost to Global Metropolis. University of California Press, Oakland 2019. 272 Seiten, geb., 29,95 $.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main