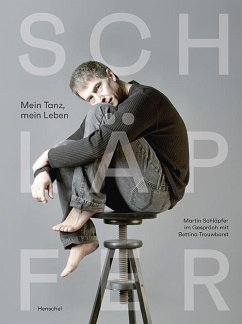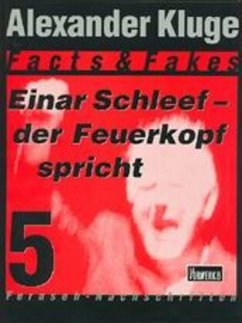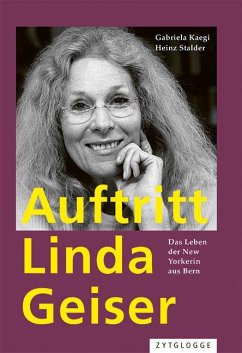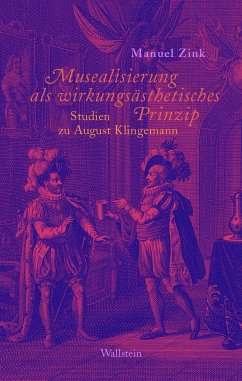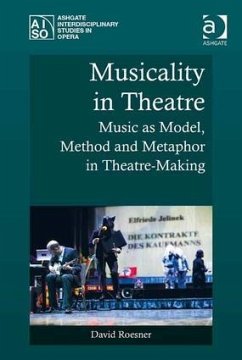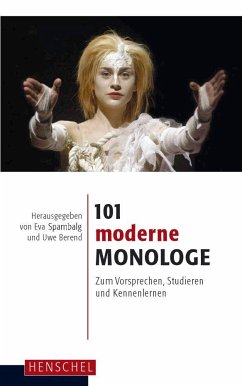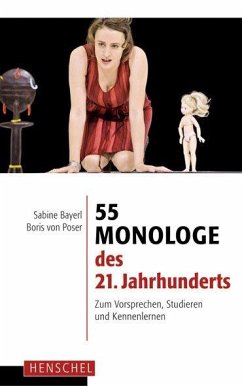Droge Faust Parsifal
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
30,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der Essay exponiert und erklärt in einer Art Berliner Dramaturgie den Stückekanon des Theatermachers Schleef - von Aischylos bis Brecht und Müller. Er ortet die Frage »Wieviel Droge braucht der Mensch?« als eine für diese Stücke bestimmende. Und er gibt mit Abschnitten der Lebensgeschichte und Gegenwartsbeobachtung des Autors den Ausführungen zu Traditionslinien des deutschen Theaters Verbindlichkeit und Aktualität.