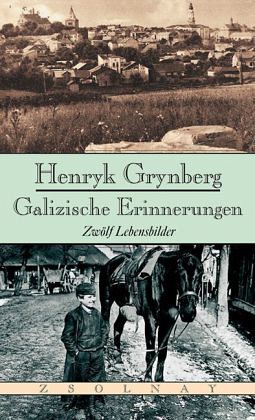"Henryk Grynberg hat ein Buch geschrieben, das man in einem Atemzug liest. Ein Buch, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Denn das Böse, das er darin beschreibt, ist nicht vom Mond gefallen. Es sitzt in uns drinnen und wartet auf seinen Moment." Gazeta Wyborcza (Warschau) "Das Unvorstellbare des Holocausts, das auch noch die überlebenden Opfer aus dem Kreis der Menschen, der durch das Mitleid geschlossen wird, zu entrücken droht, wird durch Grynbergs Prosa ins Vorstellbare zurückgeholt, in der das Dokumentarische keinen Gegensatz zum Menschlichen eingeht. Wenn ein Leben erzählt werden kann, ist es für das Leben gerettet." Eberhard Rathgeb, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.10.00 "Grynberg protokolliert bis in kleinste Details hinein,
wie die Juden aus dem öffentlichen Leben, dem Theater, den Schulen verdrängt wurden. (...) Geschrieben ist das Buch mit einfühlsamer Klarheit, intensiv in seinen Bildern und unvergesslich durch den zurückhaltenden Erzählton, der es den Lesern überlässt, sich zu fragen, woher das Böse kommt." Thomas Linden, Bonner Rundschau "Auf den ersten Blick wirkt das Buch wie 'oral history', die mündliche Wiedergabe von Erinnerungen. Es handelt sich aber bei 'Drohobycz, Drohobycz', wie Grynberg in der Nachbemerkung des Buches betont, nicht um 'Interviews', sondern um einen Text, für den er als Autor die volle Verantwortung übernimmt. Doch hat er in die Aufzeichnungen nur sehr dezent eingegriffen. So sind fesselnde Erzählungen entstanden, die nicht etwa durch detailgenaue Beschreibung einzelner Greueltaten, sondern ganz im Gegenteil, durch die lakonische Wiedergabe aufeinanderfolgender und sich zuspitzenden Ereignisse den Leser in den Bann schlägt." Jonathan Scheiner, Allgemeine Jüdische Wochenzeitung, 4.1.01 "Die Begrenztheit der Perspektive, die Schmucklosigkeit des Berichts - sie machen die Größe und Eindringlichkeit dieser Prosa aus." Hans-Harald Müller, Die Welt, 21.10.00"Zeugenschaft bekunden, Erinnerungen aufzeichnen, Wissen dem drohenden Verlöschen entwinden: vornehmliches und vornehmes Ziel des Schriftstellers, wie es Henryk Grynberg versteht. (...) Zwölf Personen .. haben dem Autor Erlebtes berichtet, auf dass er es aufzeichne in seiner Facon. (...) Das Unerträgliche dieser Texte speist sich jedoch nur zum Teil aus der Drastik der einzelnen Szene. Noch bedrückender ist deren Reihung, die an jene Albträume erinnert, aus welchen man nur scheinbar erwacht, um sich in einem weiteren wiederzufinden. Dass sich diese Albträume bis weit nach der 'Befreiung' von 1945 in Sowjetrussland und im amerikanischen Exil fortgesetzt haben, ist eine der beunruhigendsten Botschaften dieses Buches." Christiane Zintzen, Neue Zürcher Zeitung, 11.01.01