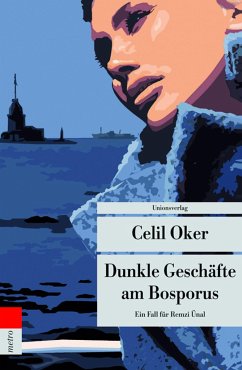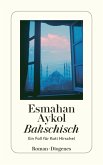Muazzez Güler, die toughe Chefin einer Computerfirma in Istanbul, kann es nicht leiden, wenn ihre Kunden nicht bezahlen. Um einem besonders hartnäckigen Schuldner Beine zu machen, setzt sie den Privatdetektiv Remzi Ünal auf ihn an. Der muss mitten in der Wirtschaftskrise jeden Auftrag annehmen. Als er jedoch sein Honorar abholen will, findet er Muazzez Güler tot in ihrem Büro vor, mit einem Mauskabel um den Hals. Schnell stellt Remzi Ünal fest, dass in dieser Geschichte gar nichts zusammenpasst. Muazzez Gülers Geschäfte beschränkten sich keineswegs auf Computerteile, und ihr Politikergatte geht für seine Karriere über Leichen. Und war es wirklich die schöne und blitzgescheite Selma, die den Politiker erpresst und damit die Sache ins Rollen gebracht hat?
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Gern ist Rezensentin Katharina Granzin Celil Oker mit seinem fünften Krimi "in den Sumpf der besseren Istanbuler Gesellschaft" gefolgt. Schuld daran ist nicht allein dessen trockener Humor und eine höchst "ungetrübte Erzählhaltung". Auch Remzi Ünal, der Protagonist, ein ehemaliger Pilot der nun als Detektiv aktiv ist, hat es ihr angetan. Denn dessen exzessivem Aikido-Training verdankt die Handlung Granzin zufolge jede Menge Action-Szenen. Auch sonst herrscht nicht gerade Handlungsarmut, wenn man der Rezensentin glauben darf. Da wird in stylische Hosen gemacht und auf coole Klamotten gekotzt, gemordet und totgeschlagen, das es die reinste Leserfreude ist. Zwar führt der "entspannte Tonfall" gelegentlich dazu, dass die Rezensentin den Faden verliert. Am Ende hatte sie trotzdem viel Spaß mit dem türkischen Macho, als den sie Protagonist Remzi beschreibt. Und Lust bekommen, nach Istanbul zu fahren.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Dass man so nebenbei unheimlich Lust bekommt, nach Istanbul zu fahren, ist als Nebeneffekt garantiert beabsichtigt.« Katharina Granzin taz.de