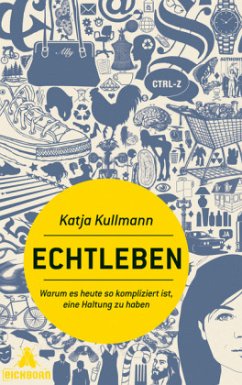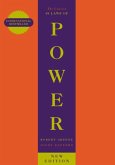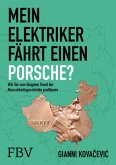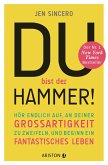Vor zehn Jahren hat uns Katja Kullmann die Generation Ally erklärt. Inzwischen hat sich die Welt mehrmals überschlagen: In der Gesellschaft geben Wirtschaftskrisen, Flexibilisierung, Erosion der Mittelschicht den Takt vor. Auf der persönlichen Ebene stellen sich die Fragen konkret: Bin ich noch bereit, meine Ideale zu verraten, um meinen sozialen Status zu halten? Was ist der Ausweg, wenn mein individualisiertes Lebenskonzept in die Sackgasse führt? - Da helfen Coolness, Ironie oder Flucht in Lifestyle-Marotten nicht weiter.
Scharfsichtig und unterhaltsam zeichnet Katja Kullmann den emotionalen Klimawandel innerhalb ihrer Generation nach. Und sie zeigt, wie vermeintlich alte Werte mit neuem Leben gefüllt und vom Muff des Konservatismus befreit werden können. Sich einmischen, kämpfen für das, was wichtig ist, sich gegen den Wind stellen: Wie kann das heute aussehen? Wer soll es tun, wenn nicht wir selbst? Es gibt doch nichts zu verlieren.
"Wenn man Jahre damit verbracht hat, sich alle Optionen offen zu halten, Anstellungen zu vermeiden, Beziehungen zu managen, sich auszukennen und auch ironisch zu bleiben, wenn der eigene soziale Status prekär wird - dann wächst die Sehnsucht nach dem Echtleben." Katja Kullmann
Scharfsichtig und unterhaltsam zeichnet Katja Kullmann den emotionalen Klimawandel innerhalb ihrer Generation nach. Und sie zeigt, wie vermeintlich alte Werte mit neuem Leben gefüllt und vom Muff des Konservatismus befreit werden können. Sich einmischen, kämpfen für das, was wichtig ist, sich gegen den Wind stellen: Wie kann das heute aussehen? Wer soll es tun, wenn nicht wir selbst? Es gibt doch nichts zu verlieren.
"Wenn man Jahre damit verbracht hat, sich alle Optionen offen zu halten, Anstellungen zu vermeiden, Beziehungen zu managen, sich auszukennen und auch ironisch zu bleiben, wenn der eigene soziale Status prekär wird - dann wächst die Sehnsucht nach dem Echtleben." Katja Kullmann

Über die finanziellen Nöte der kreativen Klasse
Sie wollten nicht wie ihre Eltern leben. Keinen Beruf erlernen, der nur dem Zweck dient, Geld zu verdienen. Um damit eine Familie zu ernähren, ein Reihenendhaus abzubezahlen, ein ansehnliches Auto vor der Tür zu parken. Sie studierten nicht Betriebswirtschaft oder Maschinenbau oder Medizin, sondern lieber Kommunikationswissenschaften oder Literatur oder Anglistik oder alles zusammen. Was sie wollten, war ein Beruf, in dem Hierarchien und Geld keine große Rolle spielen, persönliche Interessen und Kreativität dafür eine umso größere. Die Sache mit den Hierarchien und den Interessen und der Kreativität hat so weit auch geklappt - die mit dem Geld leider nicht.
In ihrem Buch "Echtleben" beschreibt die Autorin Katja Kullmann das Leben und besonders die Finanznöte der kreativen Klasse. Es geht um Menschen zwischen Mitte Dreißig und Mitte Vierzig, "fortgeschrittene Erwachsene", die sich nach ihrem erfolgreich abgeschlossenen Studium als freiberufliche Autoren oder Designer in der Kreativwirtschaft von Projekt zu Projekt hangeln, die mal stattliche Summen verdienen, mal aber auch Hartz IV beziehen, wenn es mit den Aufträgen nicht so läuft. Das alles bevorzugt in Berlin, Deutschlands Kreativhauptstadt und wohl auch der einzigen Stadt, in der es sozial anerkannt ist, keiner festen Arbeit nachzugehen, sondern "Hartzer" zu sein, wie Kullmann es nennt.
Die entscheidende Frage, um die es in ihrem Buch geht: Wie lange kann man es sich leisten, an seinen beruflichen Idealen festzuhalten? Wie lange hält man es durch, als "High Potential" auf Empfängen mit den Reichen und Mächtigen zu plaudern und Jakobsmuscheln zu schlemmen, am Ende des Monats aber weniger Geld auf dem Konto zu haben als der livrierte Kellner?
Wie lange will man ein kreativer Tagelöhner sein, dessen Arbeit der Gesellschaft zwar viel Anerkennung, aber nur wenig Geld wert ist? Legendär ist in diesem Zusammenhang ein Satz des Berliner Wirtschaftssenators Harald Wolf: "Wir können nicht nur davon leben, dass wir uns gegenseitig filmen."
Kullmann selbst bezog ein Jahr Hartz IV, hielt an ihren Idealen fest, bis sie dann freudig den Arbeitsvertrag bei einer Frauenzeitschrift unterschrieb, deren oberflächliche Texte sie früher nie lesen geschweige denn schreiben wollte. Keine Frage, es ist ein Luxusproblem, das Kullmann beschreibt, das Problem von zu Selbstverwirklichung erzogenen jungen Menschen. Doch für all ihre Freiheit, das macht Kullmanns "Echtleben" deutlich, zahlen die Kreativen einen hohen Preis. Manchmal ist es eben doch ganz schön, mit seiner Arbeit eine Familie ernähren zu können.
JULIA LÖHR.
Katja Kullmann: Echtleben.
Eichborn Verlag, Frankfurt 2011, 255 Seiten, 17,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"ECHTLEBEN ist ein wichtiges soziologisches, politisches Buch, das man immer amüsiert liest und das manchmal zum Lachen reizt, obwohl es eigentlich eine traurige Geschichte erzählt. (...) Mit poetischer Genaugikeit erzählt. (...) Es ist ein die ,Alles-wird-gut-Rhetorik der Merkel-Jahre widerlegendes Buch, das die individuellen Kosten eines politischen Schwindels vorrechnet." -- Nils Minkmar, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung , 19.6.2011
"Kullmann hat ihre Analyse der Arbeitswelt für die etwas angegrauten ,Neuen Erwachsenen wie einen soziologischen Thriller geschrieben. Sie schont sich in ihrer geschliffen formulierten Ursachenforschung selbst am wenigsten. (...) Sowohl in der Methode, als auch stilistisch hebt sich das Buch wohltuend von den üblichen, oftmals unerträglichen Lifestyle-Theoretikern aus der Zukunftsforscher-Zunft ab. Kullmanns ECHTLEBEN ist echt, weil selbst erlebt, aus nächster Nähe beobachtet, dann messerscharf analysiert und in große, oft beängstigende Zusammenhänge gesetzt." -- profil , 6. Juni 2011
"Das Nervende an Generationenbüchern ist ja, dass sie eine Generation ausrufen (Umhängetasche / X / Golf). Umso interessanter ist es, dass ausgerechnet ein Buch, das erst gar nicht den Versuch unternimmt, solch ein ,Wir zu behaupten, einem verbreiteten Lebensgefühl so nahekommt." -- KulturSPIEGEL, 30. Mai 2011
"Ein ebenso kluger wie eigenwilliger Faktencheck des neuen Kapitalismus und seiner Kulturen - amüsant... "Diesmal kein Generationen-Buch, eher ein Epochen-Buch: punktgenau und vergnüglich, die deutsche Antwort auf Stéphane Hessel, nur jünger, konkreter, origineller." -- Luzia Braun, ZDF Aspekte, Juni 2011
"Eine gelungene Gesellschaftskritik über eine Generation, die eigentlich am Drücker sein sollte, die aber immer wieder erfährt, dass sie nicht gebraucht wird." -- Margarete Kreuzer, RBB Stilbruch, 9. Juni 2011
"Kullmann hat ihre Analyse der Arbeitswelt für die etwas angegrauten ,Neuen Erwachsenen wie einen soziologischen Thriller geschrieben. Sie schont sich in ihrer geschliffen formulierten Ursachenforschung selbst am wenigsten. (...) Sowohl in der Methode, als auch stilistisch hebt sich das Buch wohltuend von den üblichen, oftmals unerträglichen Lifestyle-Theoretikern aus der Zukunftsforscher-Zunft ab. Kullmanns ECHTLEBEN ist echt, weil selbst erlebt, aus nächster Nähe beobachtet, dann messerscharf analysiert und in große, oft beängstigende Zusammenhänge gesetzt." -- profil , 6. Juni 2011
"Das Nervende an Generationenbüchern ist ja, dass sie eine Generation ausrufen (Umhängetasche / X / Golf). Umso interessanter ist es, dass ausgerechnet ein Buch, das erst gar nicht den Versuch unternimmt, solch ein ,Wir zu behaupten, einem verbreiteten Lebensgefühl so nahekommt." -- KulturSPIEGEL, 30. Mai 2011
"Ein ebenso kluger wie eigenwilliger Faktencheck des neuen Kapitalismus und seiner Kulturen - amüsant... "Diesmal kein Generationen-Buch, eher ein Epochen-Buch: punktgenau und vergnüglich, die deutsche Antwort auf Stéphane Hessel, nur jünger, konkreter, origineller." -- Luzia Braun, ZDF Aspekte, Juni 2011
"Eine gelungene Gesellschaftskritik über eine Generation, die eigentlich am Drücker sein sollte, die aber immer wieder erfährt, dass sie nicht gebraucht wird." -- Margarete Kreuzer, RBB Stilbruch, 9. Juni 2011
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Ja, die Boheme ist auch nicht mehr, was sie mal war. Frei will sie sein, das Risio des Scheiterns aber lieber nicht tragen, spottet der hier rezensierende Unternehmensberater und Journalist Jan Füchtjohann über die von Katja Kullmann porträtierten verarmten Kreativen aus der Generation der 30- bis 45-Jährigen. Ihn nervt das Gejammer. Außerdem habe Kullmann oberflächlich recherchiert und argumentiere mit wenig intellektueller Schärfe: Füchtjohann vergleicht das Buch mit einer "wütend zusammengerollten Frauenzeitschrift". Da haben Ingo Niermann ("Minusvisionen: Unternehmer ohne Geld") und Rafael Horzon ("Das Weisse Buch") Gehaltvolleres zum Thema beigetragen, findet er.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH