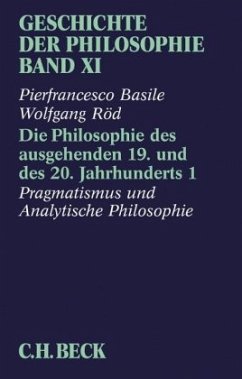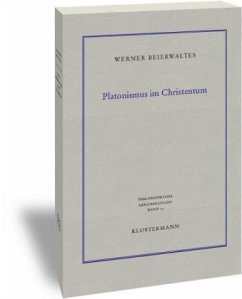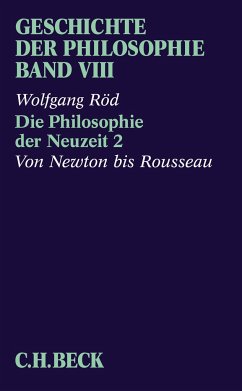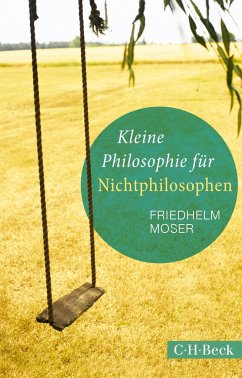Egozentrizität und Mystik
Eine anthropologische Studie

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Tugendhat unternimmt es, die Methoden der analytischen Philosophie auf anthropologische Grundfragen anzuwenden. Was bedeutet es, sich "ich"-sagend zu sich zu verhalten? Wie unterscheidet sich der Selbstbezug der Menschen von der rudimentären Egozentrizität anderer Tiere? Im Blick auf solche Fragen erörtert der Autor Phänomene wie Egoismus und Altruismus, das Bewußtsein der Sterblichkeit, Sichwichtignehmen und die Möglichkeit der Selbstrelativierung sowie das Bedürfnis nach Religion und Mystik.Eine philosophische Anthropologie geht immer von einem Grundphänomen aus. Für Tugendhat ist d...
Tugendhat unternimmt es, die Methoden der analytischen Philosophie auf anthropologische Grundfragen anzuwenden. Was bedeutet es, sich "ich"-sagend zu sich zu verhalten? Wie unterscheidet sich der Selbstbezug der Menschen von der rudimentären Egozentrizität anderer Tiere? Im Blick auf solche Fragen erörtert der Autor Phänomene wie Egoismus und Altruismus, das Bewußtsein der Sterblichkeit, Sichwichtignehmen und die Möglichkeit der Selbstrelativierung sowie das Bedürfnis nach Religion und Mystik.
Eine philosophische Anthropologie geht immer von einem Grundphänomen aus. Für Tugendhat ist das die prädikative Struktur der menschlichen Sprache, die er innerhalb der biologischen Evolution für den entscheidenden Durchbruch zum Menschlichen hält. Von dieser Struktur her analysiert er in seinem neuen Buch eine Reihe von anthropologischen Merkmalen wie "ich"-Sagen, Rationalität, Zurechnungsfähigkeit, das Bedürfnis, etwas gut zu machen, und die Angewiesenheit auf Anerkennung und auf ein Selbstwertgefühl. Religion und Mystik werden in ihrem Sinn und in ihrem Verhältnis zueinander neu bestimmt. Mystik versteht Tugendhat als Zurücktreten von der eigenen Egozentrizität, und sie kulminiert für ihn in der buddhistischen Figur des mitleidigen Bhodisattva. Die These des Buches ist: man kann nur "ich" sagen, weil man ein Bewußtsein von anderen und von einer Welt hat, und das hat zur Folge, daß Menschen in einer Spannung zwischen zwei Polen leben: sie nehmen sich "ich"-sagend absolut wichtig und leiden daran, andererseits können sie, indem sie "von sich zurücktreten", ihre Egozentrizität im Bezug zu anderen und angesichts der Welt relativieren.
Eine philosophische Anthropologie geht immer von einem Grundphänomen aus. Für Tugendhat ist das die prädikative Struktur der menschlichen Sprache, die er innerhalb der biologischen Evolution für den entscheidenden Durchbruch zum Menschlichen hält. Von dieser Struktur her analysiert er in seinem neuen Buch eine Reihe von anthropologischen Merkmalen wie "ich"-Sagen, Rationalität, Zurechnungsfähigkeit, das Bedürfnis, etwas gut zu machen, und die Angewiesenheit auf Anerkennung und auf ein Selbstwertgefühl. Religion und Mystik werden in ihrem Sinn und in ihrem Verhältnis zueinander neu bestimmt. Mystik versteht Tugendhat als Zurücktreten von der eigenen Egozentrizität, und sie kulminiert für ihn in der buddhistischen Figur des mitleidigen Bhodisattva. Die These des Buches ist: man kann nur "ich" sagen, weil man ein Bewußtsein von anderen und von einer Welt hat, und das hat zur Folge, daß Menschen in einer Spannung zwischen zwei Polen leben: sie nehmen sich "ich"-sagend absolut wichtig und leiden daran, andererseits können sie, indem sie "von sich zurücktreten", ihre Egozentrizität im Bezug zu anderen und angesichts der Welt relativieren.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.