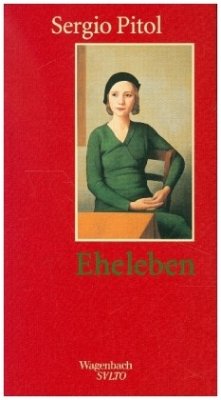Das Eheleben von Jacqueline und Nicolás ist ein Feuerwerk an misslungenen Morden. Eine Geschichte über Geld, Liebhaber, Älterwerden und andere Überlebensfragen. Mit diesem Roman wird der bedeutende mexikanische Autor erstmals auf deutsch vorgestellt.Jaqueline stiftet einen Liebhaber nach dem anderen an, ihren Mann umzubringen. Leider geht es immer schief. Der eine schafft es im entscheidenden Moment nicht, die Pistole zu erheben, der andere wird ertappt und als Dieb festgenommen, der dritte soll den Ehemann im Auto die Steilküste hinabbugsieren und verunglückt selbst. Eines Tages verschwindet Nicolás. Während Jacqueline verarmt, widmet er sich in Madrid dunklen Geschäften.Nach vielen Jahren erfährt Jacqueline, dass Nicolás nach Mexiko zurückgekehrt sei. Jacqueline hat gerade ihren sechzigsten Geburtstag gefeiert. Sie fährt zu ihm. Er empfängt sie, und obwohl er von ihren Mordprojekten erfahren hat, stellt er sie nicht zur Rede. Stattdessen kauft er zwei neue Eheringe, und sie beginnt wieder, ihn zu lieben und zu hassen. Am Schluß betritt ein altes Ehepaar ein Restaurant, verletzt, lädiert, und feiert einen neuen Hochzeitstag.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Fegefeuer aus Haß und Liebe: Sergio Pitols lustvoll perfide Ehehölle
Daß das Leben die Kunst nachahmt und sich als bevorzugtes Imitationsobjekt Balzac aussucht, wußte schon Oscar Wilde. Das größte Unglück seines Lebens nannte er den Tod des Dichters Lucien de Rubempré, und er störte sich nicht daran, diesem außerhalb der "Menschlichen Komödie" schwerlich begegnet zu sein. Eine Adeptin dürfte Wilde damit in Jacqueline Cascorreau gefunden haben. Ihre Existenz präsentiert sich als eine getreue Kopie französischer Romanvorlagen. Daß sie eigentlich María Magdalena Cascorro heißt und mit einem neureichen mexikanischen Hotelier verheiratet ist, der bei jeder Gelegenheit den Röcken seiner Bediensteten hinterherläuft, nimmt sie nur ungern zur Kenntnis. Lieber flüchtet sie sich in Literaturzirkel für unbeschäftigte Berufsgattinnen der besseren Gesellschaft. "Jede Ehe hört im Bett auf", liest sie eines Tages in der Physiologie der Ehe und muß durch Balzac erfahren, daß jede Frau nach wenigen Jahren nichts mehr als Antipathie für ihren Gatten aufbringen kann. An ihrem Hochzeitstag reift so in ihr ein finsterer Wunsch: mit Hilfe eines Liebhabers ihren Ehemann Nicolás zu ermorden. Anhand von Laclos' "Gefährlichen Liebschaften" sowie diversen Kriminalromanen klügelt sie einen Verführungs- und Mordplan aus, in dem sie selbst die perfekt inszenierte Protagonistin ist.
Doch die Vertauschung der Wirklichkeit mit ihrer Abbildung stört auch die Hierarchie von Täter und Opfer. So wie Wildes Dorian Gray auf sein Portrait einsticht und sich selbst dadurch umbringt, finden Jacquelines literarische Mordpläne immer nur ein Ziel: sie selbst. Wechselnde tatbereite Liebhaber, vom ehrgeizigen Jungpolitiker zum neurotischen Kunsthistoriker, immer neu erdachte Tötungsvarianten, Pistolen, Gift und simulierte Unfälle, können nichts daran ändern: Der stets ahnungslose Nicolás erfreut sich bester Gesundheit und steigt in die höchsten Gesellschaftskreise auf, während Jacqueline Schußwunden erleidet, den Verlust zweier Finger, Einlieferung in Nervenheilanstalten, Tablettensucht. Hinter allem aber scheint eine unbewußte Absicht zu stehen. Denn in der immer aufs neue variierten Phantasie, Nicolás zu liquidieren, findet Jacqueline ihre eigentliche Lebenserfüllung. Allein der Gedanke an den Tod des Gatten verhilft ihr zu Orgasmen. Alt und verletzt feiern Jacqueline und Nicolás so auch nach dreißig Jahren der Quälerei wieder ihren Hochzeitstag.
"Eheleben", nennt der bedeutende mexikanische Erzähler Sergio Pitol lakonisch sein erstes auf deutsch veröffentlichtes Werk. Dennoch ist dies Fegefeuer aus Haß und Liebe kein psychologisiertes Beziehungsmartyrium à la Bergman oder Antonioni. Vielmehr strahlt es eine höchst befremdliche, fast burleske Unzeitgemäßheit aus: Wie seine Heldin ahmt Pitol die französischen Romane des neunzehnten Jahrhunderts nach. In ihren Migräneanfällen, ihrem Schwanken zwischen Wunschwelt und Alltagsneurose wirkt Jacqueline wie eine tragikomisch in die neue Welt transplantierte Figur Flauberts. In ihren durch Snobismus und Halbwissen glänzenden literarischen Salons wartet man jeden Moment darauf, Swann und den Verdurins über den Weg zu laufen. Seelenruhig begleitet Pitol das Ehepaar im Mexiko des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts so, als habe er aus purem Versehen zum Schauplatz nicht den Faubourg Saint-Germain erkoren.
Daraus könnte ein leichtfüßiges postmodernes Spiel mit literarischen Versatzstücken und verdeckten Zitaten entstehen. Doch dies schlichte Vergnügen weiß der Autor uns immer wieder zu verderben. Die unpassende Fassade hat etwas zutiefst Beunruhigendes. Welch bitterböser satirischer Angriff auf die mexikanische Gesellschaft, auf ihr Groß-, ihr Kleinbürgertum, ihre politischen Eliten sich hinter ihr verbirgt, wird zuweilen offensichtlich; etwa wenn die Polizei, gleich als wäre es das Normalste der Welt, im besten Bananenrepublik-Stil in Jacquelines Haus einbricht, man sie gewaltsam verhaftet, mißhandelt, foltert. Beunruhigend ist das Buch aber auch, weil es sich konsequent einer Einordnung verweigert. Tragik und Banalität, Ernst und Lächerlichkeit purzeln auf jeder Seite ebenso durcheinander wie Liebe und Haß. Keinen Lösungsvorschlag, keinen Ausweg gewährt uns Pitol aus dieser unentwirrbaren Mischung der Stile und Emotionen, und schlimmer noch: Er erlaubt es uns nicht, eine klare Position zu beziehen. Ähnlich wie zwischen Jacqueline und Nicolás ist das Verhältnis zwischen dem Autor und seinen Figuren unmöglich auf Zuneigung oder Verachtung zu reduzieren.
"Lieber Sergio Pitol, ich bedaure, aber ich erkläre hiermit öffentlich, daß ich dir nicht traue", bemerkt Antonio Tabucchi in seinem Nachwort, einem essayistischen Kleinod, das allein schon die Lektüre des Romans lohnenswert macht. Mißtrauisch wie Raubtiere um den Dompteur lasse Pitol seine Figuren um ihren Schöpfer kreisen, stets darauf gefaßt, von ihnen in einem unbeobachteten Moment gefressen zu werden. Das Faszinierende und zugleich Perfide daran ist, und darauf scheint Tabucchis Warnung abzuzielen, daß Pitol uns die Sicherheit einer rein genießenden Lektüre verweigert. Denn eindeutig läßt sich nie vorhersagen, ob es der gierige Leser ist, der das Buch oder aber das gierige Buch ist, das den Leser verschlingt.
FLORIAN BORCHMEYER.
Sergio Pitol: "Eheleben". Aus dem mexikanischen Spanisch übersetzt von Petra Strien. Mit einem Nachwort von Antonio Tabucchi. Wagenbach Verlag, Berlin 2002. 144 S., geb., 12,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Interessant findet Leopold Feldmair diesen mexikanischen Schriftsteller, der eigentlich nur nebenberuflich schreibt, in jedem Fall. Auch wenn dieses Buch - bisher die einzige Veröffentlichung des Autors auf Deutsch - nicht sein bestes sei. "Eheleben" ist Teil einer Trilogie und entstammt einer Schaffensphase Sergio Pitols, die der Rezensent als seine "groteske oder karnevaleske Periode" bezeichnet. Das Buch ist in Feldmaiers Augen "ein zwar komischer, aber nicht fröhlicher, sondern grausamer Maskenball". Daraus ergibt sich zwar ein gewisser Unterhaltungswert, aber Pitol hat nach Ansicht des Rezensenten schon besser geschrieben. Lohnenswert findet Feldmair die Lektüre vor allem wegen des Nachworts von Antonio Tabucchi - er vermutet sogar, dass die Existent dieses Nachworts für den Verleger zumindest teilweise der Grund für die Veröffentlichung von "Eheleben" war.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Pitol ist zweifellos einer der relevantesten Vertreter der mexikanischen Literatur, eine Ikone der lateinamerikanischen Autoren und der spanischsprachigen Welt.« DIE WELT