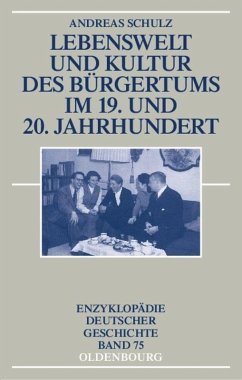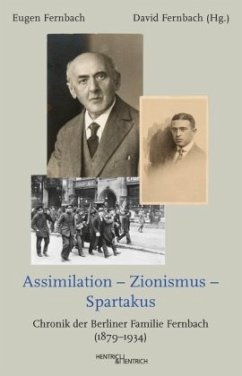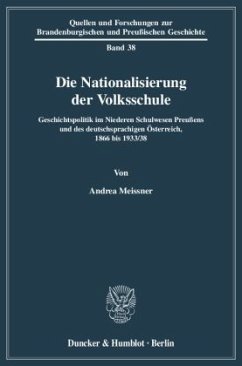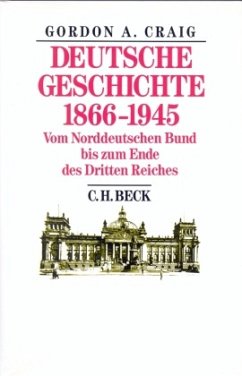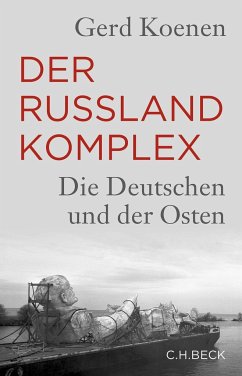Wilhelminischen Zeit bis zur endgültigen Auflösung der Korporationen 1937 darzustellen. Ihr Interesse an diesem Thema begründet sie nicht zuletzt mit dem Verweis auf ein grundlegendes Paradox: Ein namhafter Teil jüdischer Studenten in Kaiserreich und Republik eignete sich eine Organisationsform und Wertvorstellungen und Praktiken an, die nicht nur zunehmend als unzeitgemäß, als archaisch und rückwärtsgewandt kritisiert wurden, sondern den soziokulturellen Humus für einen virulenten Antisemitismus bildeten. Bereits seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts bemühten sich studentische Korporationen an deutschen Universitäten mit "Arierparagraphen" oder schlichtweg mittels einer diskriminierenden Aufnahmepraxis den Eintritt von Studierenden jüdischer Herkunft zu unterbinden - eine Politik, die in der Weimarer Zeit zum Standard wurde. Im Gegenzug gründeten jüdische Kommilitonen seit 1886 eigene Verbindungen, deren Binde- und Prägekraft sich als derart mächtig erwies, dass ihre Mitglieder teilweise noch nach der Auswanderung oder Flucht bis zu ihrem Tod, ob in den Vereinigten Staaten oder in Israel, an ihren alten "Farben" und dem hoch ritualisierten Brauchtum festhielten.
Das jüdische Verbindungswesen spiegelte seit seinen Anfängen die ideologische Binnendifferenzierung der deutschen Juden zwischen einer "deutsch-vaterländischen", jüdisch-nationalen und religiösen Richtung wider. Die Einzelgründungen schlossen sich bald in Verbänden zusammen, zuerst die "deutsch-vaterländischen" 1896 im KC, dem Kartellconvent der Verbindungen jüdischen Glaubens, der als Vorfeldorganisation des größten Zusammenschlusses deutscher Juden, des Centralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, fungierte, und in dem unmittelbar vor Beginn des Ersten Weltkriegs aus der Fusion zweier Kartelle entstandenen zionistisch orientierten KJV, dem Kartell Jüdischer Verbindungen. Diese waren keineswegs Massenorganisationen. 1913 verzeichnete der KC um die 930 Mitglieder in zehn Verbindungen. Das konkurrierende KJV umfasste bei seiner Gründung 1914 dreizehn Verbindungen und zählte 1919 knapp 490 Angehörige. Die Korporierten stellten unter den jüdischen Studenten eine Minderheit dar. Vor dem Ersten Weltkrieg war ein knappes Drittel unter ihnen organisiert, während dieser Anteil bei den nichtjüdischen Studierenden immerhin fast 80 Prozent betrug.
Frau Rürup will das jüdische Verbindungswesen nicht, wie in der Forschung meist praktiziert, als Reflex auf den Antisemitismus oder im Fall der jüdisch-nationalen Korporationen als Kern der zionistischen Bewegung interpretieren, sondern deutet den Aufbau jüdischer Verbindungen vielmehr als "Platzgewinn im akademischen Feld", als Ausdruck des Bestrebens einer Elite jüdischer junger Männer, sich ihre Zugehörigkeit zur "Ehrgemeinschaft" der satisfaktionsfähigen Gesellschaft zu sichern und das Stereotyp des "weibischen", "feigen" Juden für immer hinter sich zu lassen. Damit übernahmen die jüdischen Studenten auch bestimmte Vorstellungen und Inszenierungen von Männlichkeit, einen "schneidigen", zackigen kommentmäßigen Habitus, den sie im Auftritt in vollem Wichs, auf dem Paukboden sowie auf Kneipe und im Kommers einübten und demonstrierten.
Symptomatisch für die Fixierung jüdischer Verbindungsstudenten auf den Wertehorizont der Korporationen erscheint der Umstand, dass ihren Mitgliedern über alle Konflikte hinweg bis in den Ersten Weltkrieg hinein eine Abwehr des Antisemitismus nahezu ausschließlich auf "studentische Weise", das heißt in den Bahnen des Komments, nötig und denkbar erschien, aus dem sie antisemitische Korporationen, zunehmend aber auch akademische Organe ausschlossen. Die Imagination von Gleichheit und Zugehörigkeit über den gemeinsamen Nenner eines bestimmten Ideals von Männlichkeit ließ sich im Alltag nicht einlösen. In der Weimarer Zeit führte die Identifikation der jüdischen Korporationen mit der Republik neben dem erstarkenden Antisemitismus zu ihrer Exklusion aus der angestrebten Gemeinschaft mit anderen Verbindungen.
Handelten die jüdischen Verbindungsstudenten wie ein Dienstmädchen, "das sich die Kleider der Herrin angezogen hat und nun deren Benehmen und Sprachweise mit heißem Bemühen nachahmt", wie ein ehemaliger Korporierter in seinen Erinnerungen bemerkte? Für Frau Rürup stellt der Gegenstand ihrer Untersuchung weit mehr dar als nur das Beispiel der Adaptation einer Hegemonialkultur durch soziale Außenseiter. Im verbindungsstudentischen Umfeld verdichteten sich Debatten über Fragen der Zugehörigkeit und Orientierung der deutschen Juden. Im Kontext der Korporationen konnte sich ein spezifischer jüdischer Ehrbegriff entwickeln. Die Korporationen waren soziale Orte eines neuen Selbstbewusstseins. Die erste jüdische Verbindung, die Breslauer Viadrina, wählte demonstrativ die Farben der deutschen Urburschenschaft. Die gelbe Farbe des mittelalterlichen Schandflecks wurde vom Stigma zum Zeichen des Stolzes umdefiniert. Zionistische Korporationen entwickelten aus verbindungsstudentischen Ritualen eine eigene national-jüdische Festkultur: Die Makkabäerfeier wurde in Kommersform begangen, die Zeder am Jordanstrand nach der Melodie der "Wacht am Rhein" besungen, was nicht ausschloss, dass man bis in den Ersten Weltkrieg hinein auch Kaisers Geburtstag feierte. Die daraus resultierende Widersprüchlichkeit kommt im empörten Kommentar eines niederländischen Juden kurz vor Kriegsbeginn 1914 zum Ausdruck, der sich über das Auftreten deutscher zionistischer Verbindungsstudenten bei einer Palästina-Fahrt, über deren "deutsch-imperialistische Einkleidung" und "horrende Unjüdischkeit" beklagte.
Ein zentraler Befund der umfassenden Studie, die Organisationsgeschichte in einer erhellenden sozial- und kulturgeschichtlichen Perspektive bietet, verweist auf die tiefe Prägung männlicher deutsch-jüdischer Eliten durch die verbindungsstudentische Sozialisation. Das Bild vom Einzug deutscher zionistischer Studenten in jüdische Kolonien in Palästina in strammer Marschformation und unter Absingen deutscher Lieder, der das große Befremden des holländischen Kommilitonen auslöste, gehört so auch zur Vorgeschichte des Staates Israel.
MARTIN BAUMEISTER.
Miriam Rürup: Ehrensache. Jüdische Studentenverbindungen an deutschen Universitäten 1886-1937. Wallstein Verlag, Göttingen 2008. 502 S., 40,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main





 Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.12.2008
Frankfurter Allgemeine Zeitung | Besprechung von 02.12.2008