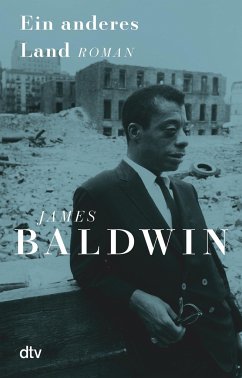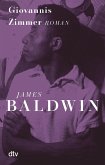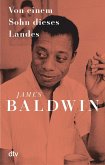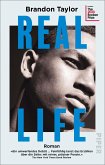Baldwins explizitester, leidenschaftlichster Roman
Warum hat Rufus Scott, ein begnadeter schwarzer Jazzer aus Harlem, sich das Leben genommen? Wegen seiner Amour fou mit der weißen Leona, die nicht sein durfte? Verzweifelt sucht Rufus' Schwester Ida nach einer Erklärung, findet aber nur Wahrheiten, die neue Wunden schlagen. Wie ihr Bruder war Ida lange bereit, sich selbst zu verleugnen, um ihren Traum, Sängerin zu werden, zu verwirklichen. Beide haben ihre Wut über die Diskriminierung durch die Weißen immer zu unterdrücken versucht. Bis jetzt. Baldwin verwickelt uns in ein gefährliches Spiel von Liebe und Hass - vor der Kulisse eines Amerikas, das sich selbst in Trümmer legt.
Warum hat Rufus Scott, ein begnadeter schwarzer Jazzer aus Harlem, sich das Leben genommen? Wegen seiner Amour fou mit der weißen Leona, die nicht sein durfte? Verzweifelt sucht Rufus' Schwester Ida nach einer Erklärung, findet aber nur Wahrheiten, die neue Wunden schlagen. Wie ihr Bruder war Ida lange bereit, sich selbst zu verleugnen, um ihren Traum, Sängerin zu werden, zu verwirklichen. Beide haben ihre Wut über die Diskriminierung durch die Weißen immer zu unterdrücken versucht. Bis jetzt. Baldwin verwickelt uns in ein gefährliches Spiel von Liebe und Hass - vor der Kulisse eines Amerikas, das sich selbst in Trümmer legt.
Der afroamerikanische Autor konnte das alles sein, schwarz, weiss, jung, alt, hetero-, homosexuell. Manuel Müller NZZ 20210925
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Rezensent Manuel Müller stellt Vermutungen darüber an, was James Baldwin weiteratmen ließ. Anhand von Baldwins Roman in der "hervorragenden" Neuübersetzung von Miriam Mandelkow kommt er drauf: Ein Afroamerikaner bewahrt sich die Menschlichkeit noch unter dem Eindruck von Rassismus und Gewalt, dem weißen Täter kommt sie abhanden. Wie facettenreich Baldwin das Greenwich Village der 50er schildert, den sich überall einschleichenden Rassismus, findet Müller stark. Baldwins Wagemut lässt sich anhand dieses Buches erkennen, das für Müller repräsentativ für das Werk des Autors ist.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Im Treibsand
der Boheme
In „Ein anderes Land“ erzählte James Baldwin von
einem mit sich kämpfenden Milieu, das er gut kannte
VON SIGRID LÖFFLER
Die Zeit war reif für die Wiederentdeckung James Baldwins als einem der bedeutendsten, wenn auch nicht besten amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Und das schon ehe die „Black Lives Matter“-Bewegung die Welt ergriff und Baldwin zu ihrer Galionsfigur erkor. Auch fast siebzig Jahre nach dem Erscheinen von Baldwins Debütroman „Go Tell it on the Mountain“ sichert dessen feurige Vehemenz und sprachliche Wucht dem Autor seinen kanonischen Platz in der afroamerikanischen Literatur – als Kritiker und Ankläger der rassistisch gespaltenen amerikanischen Gesellschaft. Kommt hinzu, dass sich seine furiosen Essays ihre politische Brisanz bewahrt haben und Baldwins Rang als public intellectual und Vorkämpfer der Bürgerrechtsbewegung bis heute, mehr als dreißig Jahre nach seinem Tod, beglaubigen.
Was Wunder, dass der woke Münchner Dtv-Verlag mit seinem Ehrgeiz im Aufspüren vergessener Klassiker des Gegenkanons des 20. Jahrhunderts das Revival von Baldwins Werk seit 2018 zu seinem Projekt macht. In neuen Übersetzungen durch Miriam Mandelkow liegen die Hauptwerke inzwischen vor: der autobiografische Debütroman über das Aufwachsen unter Erweckungschristen im schwarzen Ghetto von Harlem (leider unter dem blassen deutschen Titel „Von dieser Welt“); die Liebesgeschichte „Giovannis Zimmer“, längst ein Schwulen-Klassiker; und der Essayband „Nach der Flut das Feuer“.
Jetzt kommen Baldwins spätere Romane an die Reihe – nach „Beale Street Blues“ von 1974 nun also „Ein anderes Land“ von 1962, ein Werk, an dem Baldwin vierzehn Jahre lang laborierte, auf drei Kontinenten, in New York, Paris und Istanbul, immer am Rande des Scheiterns, während das Manuskript unter seinen Händen immer weiter aufquoll. Das macht den Roman zu einer Art Lackmustest, an dem sich Baldwins literarische Wertig- und Haltbarkeit überprüfen lässt.
Der Roman spielt im New York der 1950er-Jahre an zwei konträren Schauplätzen, in Harlem und im Künstlerviertel Greenwich Village. Rund um das zentrale schwarze Geschwisterpaar Rufus und Ida, die es unbedingt aus dem gewalttätigen Elend von Harlem rausschaffen wollen, er als Jazzmusiker, sie als Blues-Sängerin, gruppiert Baldwin eine Handvoll ihrer Freunde und Freundinnen – lauter liberale Village-Weiße, Bohemiens und Künstler, die sich auf ihre Vorurteilslosigkeit gegenüber Schwarzen einiges zugutehalten.
Die ersten 120 Seiten des Romans gehören Rufus, einem Verlorenen von allem Anfang an. Er fühlt sich als Außenseiter unter Schwarzen wie auch unter Weißen, ist sich seiner (auch sexuellen) Identität nicht sicher und wittert überall Diskriminierung, teils tatsächlich zu Recht, teils eingebildet. Seine schwarze Familie in Harlem und die weißen Freunde in Lower Manhattan, vor allem sein bester Freund Vivaldo, sorgen sich um ihn, können ihm aber nicht helfen.
Selbstzweifel, Hass und Wut brodeln in Rufus und entladen sich in Misshandlungen seiner Freundin Leona, die dem White Trash der Südstaaten und einem gewalttätigen Ehemann entflohen ist, um in New York ein neues Leben zu beginnen. Doch ihre Affäre mit Rufus endet in wechselseitiger Zerstörung. Leona landet im Irrenhaus, und Rufus, zerrüttet von Scham, Selbstverachtung und Selbstekel, springt von der Washington Bridge in den Tod.
Auf diese krasse Exposition des Doppelthemas Identität und Rassismus im Rufus-Kapitel folgt nun die symphonische Durchführung: Auf den restlichen 430 Seiten des Romans spielt Baldwin die Themen der Rassenproblematik und der sexuellen Identitätskrisen als tema con variazioni durch. Erzählt wird, wie es mit Rufus’ Schwester Ida und seinem Freundeskreis im Village in den Trauermonaten nach seinem Suizid weitergeht. Alle suchen die Liebe, während sie sich in schwarz-weißen, homo- und heterosexuellen Mischungen vielfach miteinander verstricken, halb tragisch, halb melodramatisch.
Was immer deutlicher wird: Um Rassismus geht es nur am Rande; Baldwins eigentliches Thema sind die Konzepte von Männlichkeit, an denen er sich abarbeitet. Seine Männerfiguren beanspruchen ganz selbstverständlich die Bisexualität für sich, den Frauen wird das versagt – sie bleiben alle einzig auf Männer sexuell angewiesen. Ida beginnt eine Affäre mit Vivaldo, die zur fatalen Kopie der Hassliebe zwischen Rufus und Leona ausartet, und betrügt ihren Lover zugleich mit einem lüsternen weißen Impresario, der sie als Sängerin groß rauszubringen verspricht.
Ein weißes Paar, Cass und Richard, bisher das gastfreundliche Wohlfühlzentrum dieser trinkenden, rauchenden und kunststümpernden Boheme, entzweit sich, als Richard einen unverhofften Bucherfolg landet und Cass sich in eine Affäre mit dem schwulen Schauspieler Eric stürzt, der bereits mit Rufus liiert war, nun in einen Pariser Strichjungen verliebt ist und zugleich den betrogenen Vivaldo mit einem One-Night-Stand zu trösten versucht.
Baldwin entfaltet hier ein Milieu, das er aus eigenem Erleben nur allzu gut kannte – die Underground-Künstlerszene des Village, in der strampelnde Talente und alternative Spießer zwischen Erfolg und Scheitern balancierten, „bevor sie im allgegenwärtigen Treibsand einer ziellosen, geschlagenen und gereizten Boheme versanken“. Doch die Romanfiguren bleiben seltsam flach und konturlos. Vermutlich sollen wir sie als Dilettanten der Kunst, der Liebe und des Lebens wahrnehmen, aber sie werden nicht recht lebendig.
Baldwin geht es da wie seiner Figur Vivaldo, diesem Möchtegern-Schriftsteller, der sich mit einem Roman abquält und in einer Anwandlung von frustrierter Hellsicht erkennt: „Irgendwie kannte er die Menschen in seinem Roman nicht gut genug. Irgendwie vertrauten sie ihm nicht. Sie hatten alle Namen, mehr oder weniger, hatten alle mehr oder weniger eine Bestimmung. Er konnte sie hin und her bewegen, aber sie selbst bewegten sich nicht. Er legte ihnen Wörter in den Mund, die sie mürrisch aussprachen, ohne Überzeugung.“
Irgendwie. Mehr oder weniger. Ohne Überzeugung.
Um seinem scheintoten Personal aufzuhelfen, bedient sich Baldwin hauptsächlich des Dialogs als Mittel der Wahl, um das voranzubringen, was im rieselnden Treibsand dieses Romans als Handlung herhalten soll. So minimal das Geschehen, so ausufernd wird darüber diskutiert. Je weniger im Roman passiert, desto größer das Erörterungsbedürfnis. Ein expressiver Pseudo-Naturalismus lässt hier Muskeln spielen, die er gar nicht hat. Das Kraftvokabular soll über die Blutleere hinwegtäuschen. Das liest sich bisweilen wie eine mimetische Vorwegnahme der oratorischen Ausschweifungen psychotherapeutischer Gruppensitzungen.
Jedenfalls werden in diesen empfindsamen Gesprächssitzungen unentwegt Zigaretten angezündet und Aschenbecher gesucht, immerfort wird Bourbon nachgeschenkt, ständig steigen Tränen in die Augen, es wird errötet und erbleicht, das Blut weicht aus den Gesichtern, und Herzen zucken vor Schreck. In diesem Roman wird weit mehr gebarmt und tränenblind gezittert, als ihm sprachlich guttut. Über Baldwins rhetorischen Salto rückwärts in den trivialen Gefühlskitsch kann man sich nur wundern, verglichen mit dem Tremolo der Wehklagen, dem ekstatischen Gospel-Sound und den donnernden Jeremiaden seines Debütromans „Go Tell it on the Mountain“.
Die sprachliche Missgestalt verweist auf ein tieferes Manko, eine intellektuelle Schwäche Baldwins in seinen mittleren Jahren. Eine Sehnsucht nach Glimpflichkeit stimmt ihn verdächtig kompromisslerisch. Alle Konflikte im Roman enden mit halben Versöhnungen im Geiste einer vagen allgemeinen Menschlichkeit. Irgendwie. Mehr oder weniger. Ohne Überzeugung.
Vierzehn Jahre laborierte der
Autor an diesem Roman,
immer am Rande des Scheiterns
Um seinem scheintoten
Personal aufzuhelfen, bedient
er sich des Dialogs
James Baldwin: Ein
anderes Land. Roman.
Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow.
dtv, München 2021.
572 Seiten, 25 Euro.
James Baldwins Rang als „public intellectual“ bleibt bis heute bestehen: 1987 starb der amerikanische Schriftsteller in Frankreich.
Foto: Ralph Gatti/afp
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de
der Boheme
In „Ein anderes Land“ erzählte James Baldwin von
einem mit sich kämpfenden Milieu, das er gut kannte
VON SIGRID LÖFFLER
Die Zeit war reif für die Wiederentdeckung James Baldwins als einem der bedeutendsten, wenn auch nicht besten amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Und das schon ehe die „Black Lives Matter“-Bewegung die Welt ergriff und Baldwin zu ihrer Galionsfigur erkor. Auch fast siebzig Jahre nach dem Erscheinen von Baldwins Debütroman „Go Tell it on the Mountain“ sichert dessen feurige Vehemenz und sprachliche Wucht dem Autor seinen kanonischen Platz in der afroamerikanischen Literatur – als Kritiker und Ankläger der rassistisch gespaltenen amerikanischen Gesellschaft. Kommt hinzu, dass sich seine furiosen Essays ihre politische Brisanz bewahrt haben und Baldwins Rang als public intellectual und Vorkämpfer der Bürgerrechtsbewegung bis heute, mehr als dreißig Jahre nach seinem Tod, beglaubigen.
Was Wunder, dass der woke Münchner Dtv-Verlag mit seinem Ehrgeiz im Aufspüren vergessener Klassiker des Gegenkanons des 20. Jahrhunderts das Revival von Baldwins Werk seit 2018 zu seinem Projekt macht. In neuen Übersetzungen durch Miriam Mandelkow liegen die Hauptwerke inzwischen vor: der autobiografische Debütroman über das Aufwachsen unter Erweckungschristen im schwarzen Ghetto von Harlem (leider unter dem blassen deutschen Titel „Von dieser Welt“); die Liebesgeschichte „Giovannis Zimmer“, längst ein Schwulen-Klassiker; und der Essayband „Nach der Flut das Feuer“.
Jetzt kommen Baldwins spätere Romane an die Reihe – nach „Beale Street Blues“ von 1974 nun also „Ein anderes Land“ von 1962, ein Werk, an dem Baldwin vierzehn Jahre lang laborierte, auf drei Kontinenten, in New York, Paris und Istanbul, immer am Rande des Scheiterns, während das Manuskript unter seinen Händen immer weiter aufquoll. Das macht den Roman zu einer Art Lackmustest, an dem sich Baldwins literarische Wertig- und Haltbarkeit überprüfen lässt.
Der Roman spielt im New York der 1950er-Jahre an zwei konträren Schauplätzen, in Harlem und im Künstlerviertel Greenwich Village. Rund um das zentrale schwarze Geschwisterpaar Rufus und Ida, die es unbedingt aus dem gewalttätigen Elend von Harlem rausschaffen wollen, er als Jazzmusiker, sie als Blues-Sängerin, gruppiert Baldwin eine Handvoll ihrer Freunde und Freundinnen – lauter liberale Village-Weiße, Bohemiens und Künstler, die sich auf ihre Vorurteilslosigkeit gegenüber Schwarzen einiges zugutehalten.
Die ersten 120 Seiten des Romans gehören Rufus, einem Verlorenen von allem Anfang an. Er fühlt sich als Außenseiter unter Schwarzen wie auch unter Weißen, ist sich seiner (auch sexuellen) Identität nicht sicher und wittert überall Diskriminierung, teils tatsächlich zu Recht, teils eingebildet. Seine schwarze Familie in Harlem und die weißen Freunde in Lower Manhattan, vor allem sein bester Freund Vivaldo, sorgen sich um ihn, können ihm aber nicht helfen.
Selbstzweifel, Hass und Wut brodeln in Rufus und entladen sich in Misshandlungen seiner Freundin Leona, die dem White Trash der Südstaaten und einem gewalttätigen Ehemann entflohen ist, um in New York ein neues Leben zu beginnen. Doch ihre Affäre mit Rufus endet in wechselseitiger Zerstörung. Leona landet im Irrenhaus, und Rufus, zerrüttet von Scham, Selbstverachtung und Selbstekel, springt von der Washington Bridge in den Tod.
Auf diese krasse Exposition des Doppelthemas Identität und Rassismus im Rufus-Kapitel folgt nun die symphonische Durchführung: Auf den restlichen 430 Seiten des Romans spielt Baldwin die Themen der Rassenproblematik und der sexuellen Identitätskrisen als tema con variazioni durch. Erzählt wird, wie es mit Rufus’ Schwester Ida und seinem Freundeskreis im Village in den Trauermonaten nach seinem Suizid weitergeht. Alle suchen die Liebe, während sie sich in schwarz-weißen, homo- und heterosexuellen Mischungen vielfach miteinander verstricken, halb tragisch, halb melodramatisch.
Was immer deutlicher wird: Um Rassismus geht es nur am Rande; Baldwins eigentliches Thema sind die Konzepte von Männlichkeit, an denen er sich abarbeitet. Seine Männerfiguren beanspruchen ganz selbstverständlich die Bisexualität für sich, den Frauen wird das versagt – sie bleiben alle einzig auf Männer sexuell angewiesen. Ida beginnt eine Affäre mit Vivaldo, die zur fatalen Kopie der Hassliebe zwischen Rufus und Leona ausartet, und betrügt ihren Lover zugleich mit einem lüsternen weißen Impresario, der sie als Sängerin groß rauszubringen verspricht.
Ein weißes Paar, Cass und Richard, bisher das gastfreundliche Wohlfühlzentrum dieser trinkenden, rauchenden und kunststümpernden Boheme, entzweit sich, als Richard einen unverhofften Bucherfolg landet und Cass sich in eine Affäre mit dem schwulen Schauspieler Eric stürzt, der bereits mit Rufus liiert war, nun in einen Pariser Strichjungen verliebt ist und zugleich den betrogenen Vivaldo mit einem One-Night-Stand zu trösten versucht.
Baldwin entfaltet hier ein Milieu, das er aus eigenem Erleben nur allzu gut kannte – die Underground-Künstlerszene des Village, in der strampelnde Talente und alternative Spießer zwischen Erfolg und Scheitern balancierten, „bevor sie im allgegenwärtigen Treibsand einer ziellosen, geschlagenen und gereizten Boheme versanken“. Doch die Romanfiguren bleiben seltsam flach und konturlos. Vermutlich sollen wir sie als Dilettanten der Kunst, der Liebe und des Lebens wahrnehmen, aber sie werden nicht recht lebendig.
Baldwin geht es da wie seiner Figur Vivaldo, diesem Möchtegern-Schriftsteller, der sich mit einem Roman abquält und in einer Anwandlung von frustrierter Hellsicht erkennt: „Irgendwie kannte er die Menschen in seinem Roman nicht gut genug. Irgendwie vertrauten sie ihm nicht. Sie hatten alle Namen, mehr oder weniger, hatten alle mehr oder weniger eine Bestimmung. Er konnte sie hin und her bewegen, aber sie selbst bewegten sich nicht. Er legte ihnen Wörter in den Mund, die sie mürrisch aussprachen, ohne Überzeugung.“
Irgendwie. Mehr oder weniger. Ohne Überzeugung.
Um seinem scheintoten Personal aufzuhelfen, bedient sich Baldwin hauptsächlich des Dialogs als Mittel der Wahl, um das voranzubringen, was im rieselnden Treibsand dieses Romans als Handlung herhalten soll. So minimal das Geschehen, so ausufernd wird darüber diskutiert. Je weniger im Roman passiert, desto größer das Erörterungsbedürfnis. Ein expressiver Pseudo-Naturalismus lässt hier Muskeln spielen, die er gar nicht hat. Das Kraftvokabular soll über die Blutleere hinwegtäuschen. Das liest sich bisweilen wie eine mimetische Vorwegnahme der oratorischen Ausschweifungen psychotherapeutischer Gruppensitzungen.
Jedenfalls werden in diesen empfindsamen Gesprächssitzungen unentwegt Zigaretten angezündet und Aschenbecher gesucht, immerfort wird Bourbon nachgeschenkt, ständig steigen Tränen in die Augen, es wird errötet und erbleicht, das Blut weicht aus den Gesichtern, und Herzen zucken vor Schreck. In diesem Roman wird weit mehr gebarmt und tränenblind gezittert, als ihm sprachlich guttut. Über Baldwins rhetorischen Salto rückwärts in den trivialen Gefühlskitsch kann man sich nur wundern, verglichen mit dem Tremolo der Wehklagen, dem ekstatischen Gospel-Sound und den donnernden Jeremiaden seines Debütromans „Go Tell it on the Mountain“.
Die sprachliche Missgestalt verweist auf ein tieferes Manko, eine intellektuelle Schwäche Baldwins in seinen mittleren Jahren. Eine Sehnsucht nach Glimpflichkeit stimmt ihn verdächtig kompromisslerisch. Alle Konflikte im Roman enden mit halben Versöhnungen im Geiste einer vagen allgemeinen Menschlichkeit. Irgendwie. Mehr oder weniger. Ohne Überzeugung.
Vierzehn Jahre laborierte der
Autor an diesem Roman,
immer am Rande des Scheiterns
Um seinem scheintoten
Personal aufzuhelfen, bedient
er sich des Dialogs
James Baldwin: Ein
anderes Land. Roman.
Aus dem Englischen von Miriam Mandelkow.
dtv, München 2021.
572 Seiten, 25 Euro.
James Baldwins Rang als „public intellectual“ bleibt bis heute bestehen: 1987 starb der amerikanische Schriftsteller in Frankreich.
Foto: Ralph Gatti/afp
DIZdigital: Alle Rechte vorbehalten – Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.sz-content.de