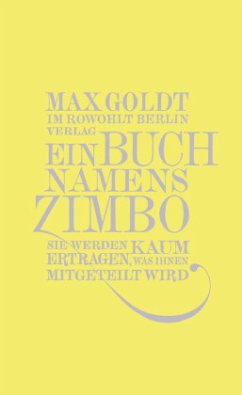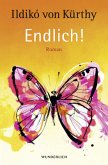"Max Goldt gehört gelesen, gerühmt und ausgezeichnet." (Daniel Kehlmann)
«Warum ich, obwohl ich schlecht lesen kann, begonnen habe zu schreiben, kann ich nicht gut sagen. Weiß nicht hat sich so ergeben. Spät hat es sich ergeben: Als ich mein erstes Stück Literatur verfasste, das über einen Songtext, ein Gedicht oder einen Sketch hinausging, war ich knapp dreißig. Ich dachte wohl: Mal sehen, ob es möglich ist, der Neigung meines Temperaments zum Schieben einer ruhigen Kugel für ein, zwei Tage einen Riegel vorzuschieben und dem ständigen Gedankengang, an dem ich mich meist erfreue, selten auch mal leide, einen irgendwie gearteten Prosaklumpen abzutrotzen. Das Stück hieß Zehn hoch achtundfünfzig und es ging darin, soweit ich mich entsinne, ums Universum und um meine Hose. Genaueres kann ich nicht sagen, denn ich würde schwitzen wie nach dem Genuss eines stark gewürzten asiatischen Gerichtes, wenn ich mir den Text noch einmal anschauen müsste. Was ich danach geschrieben habe: Auch schwer zu sagen, doch glaube ich, unter anderem einen hoffentlich verzeihlichen Hang zur hoffentlich nicht allzu platten Gesellschaftskritik entwickelt zu haben, wobei ich Gesellschaftskritik nie mit System- oder Regierungskritik verwechseln wollte, denn Gesellschaftskritik, die das Grölen von Fußballfans in Bahnhöfen ganz unerwähnt lässt, ist keine.» (Max Goldt, aus der Dankesrede zum Kleist-Preis)
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
«Warum ich, obwohl ich schlecht lesen kann, begonnen habe zu schreiben, kann ich nicht gut sagen. Weiß nicht hat sich so ergeben. Spät hat es sich ergeben: Als ich mein erstes Stück Literatur verfasste, das über einen Songtext, ein Gedicht oder einen Sketch hinausging, war ich knapp dreißig. Ich dachte wohl: Mal sehen, ob es möglich ist, der Neigung meines Temperaments zum Schieben einer ruhigen Kugel für ein, zwei Tage einen Riegel vorzuschieben und dem ständigen Gedankengang, an dem ich mich meist erfreue, selten auch mal leide, einen irgendwie gearteten Prosaklumpen abzutrotzen. Das Stück hieß Zehn hoch achtundfünfzig und es ging darin, soweit ich mich entsinne, ums Universum und um meine Hose. Genaueres kann ich nicht sagen, denn ich würde schwitzen wie nach dem Genuss eines stark gewürzten asiatischen Gerichtes, wenn ich mir den Text noch einmal anschauen müsste. Was ich danach geschrieben habe: Auch schwer zu sagen, doch glaube ich, unter anderem einen hoffentlich verzeihlichen Hang zur hoffentlich nicht allzu platten Gesellschaftskritik entwickelt zu haben, wobei ich Gesellschaftskritik nie mit System- oder Regierungskritik verwechseln wollte, denn Gesellschaftskritik, die das Grölen von Fußballfans in Bahnhöfen ganz unerwähnt lässt, ist keine.» (Max Goldt, aus der Dankesrede zum Kleist-Preis)
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Wenn uns im Vorbeigehen etwas auffällt, gehen wir in der Regel daran vorbei. Wo kämen wir hin, wenn jeder an jeder Straßenecke stehenbliebe, um etwa einem besonders elegant verwendeten Konjunktiv zu lauschen. Wenn Max Goldt im Vorbeigehen etwas auffällt, geht er in der Regel daran vorbei. Nun ist er aber jemand, der "etwas Erinnertes zunächst im Hirnkasten verschließt, damit es Verbindungen mit anderem, was dort gärt und lagert, eingehen kann" und dann, "wenn der Tag gekommen ist", reizende Texte daraus baut. So beschreibt er, wie ihm in den achtziger Jahren "das wahrhaftige Preußen" in Gestalt der Diseuse Blandine Ebinger begegnete: "plötzlich saß es winzig vor mir und verlangte, dass ich gerade stehe und lauter singe!" Ein anderer quälend komischer Text handelt von Arnold Stadlers These, Glück sei literarisch nicht interessant. Besonders elegant zeigt sich Goldt bei der Sprachkritik. Apropos: In keinem der vierundzwanzig Aufsätze findet sich ein Hinweis darauf, warum "Zimbo" ein guter Name für ein Buch sein sollte. Aber ginge es uns etwas an, hätte Goldt es mitgeteilt. Weitergehen! (Max Goldt: "Ein Buch namens Zimbo. Sie werden kaum ertragen, was Ihnen mitgeteilt wird". Rowohlt Verlag, Berlin 2009. 199 S., geb., 17,90 [Euro].) edie
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Rezensent Michael Rutschky outet sich als großer Fan von Max Goldt. Da dessen Stil zwar wirklich besonders ist, aber im Grundsätzlichen nur wenig variiert, widmet er sich in seiner Besprechung dem neuen "Buch namens Zimbo" nur am Rande. Den Titel kann er sich lediglich mit einem Verweis auf Goldts "Hermetismus" erklären, geheime Traditionen", in die man entweder eingeweiht ist oder nicht, erklärt bekommt man sie jedenfalls nicht. Meist aber bemüht sich Rutschky in seinem Text um eine allgemeine Kategorisierung von Goldts Schreibstil. "Stillleben" sind sie seiner Meinung nach, wobei Goldt die "Monumentalthemen" nur im Vorbeigehen streife und damit sehr geschickt Peinlichkeiten aller Art vermeide. Trotzdem beweist er nach Meinung des Rezensenten ein "absolutes Gehör", was die "Sittenverstöße des modernen Lebens" angeht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Aha, der Knigge und Ovids Liebeskunst also. Das sind die Vorbilder, die Burkhard Müller dem Autor der hier versammelten Texte schmeichelnd unterstellt, wenn er konstatiert, Max Goldt gehe es um die sanfte Kontrolle und Korrektur seiner Mitmenschen. Etwa, wenn Goldt sich den Vorzügen der Umhängetasche widmet oder der Beleuchtung in Hotelzimmern, in denen man überhaupt nicht mehr lesen kann. Stets kommt für Müller dabei scheinbar Offensichtliches zu seinem Recht, wird Naheliegendes betont und zum Bedenken angeregt. Und wenn Goldt dabei manchmal unnötig kompliziert und kauzig wird, so hat Müller Nachsicht: Es ist bloß das wilde Fuchteln des einsamen Rufers um Aufmerksamkeit.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH