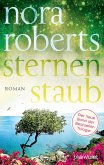Sommer 1972. Benjamin ist vor einigen Wochen elf geworden. Im nächsten Schuljahr wird er ein Herrenrad bekommen, eine Freundin und vielleicht eine tiefe Stimme. Doch dann stirbt sein kleiner Bruder Jonas. Nachts sitzt Bens Mutter auf einer Heizdecke und weint. Ben kommt nun extra pünktlich nach Hause, er spielt ihr auf der C-Flöte vor und unterhält sich mit ihr über den Archäopteryx. An Jonas denkt er immer seltener. Ben hat mit dem Leben zu tun, er muss für das Fußballtor wachsen, sein bester Freund erklärt ihm die Eierstöcke, und sein erster Kuss schmeckt nach Regenwurm. Mit seiner neuen Armbanduhr berechnet er die Zeit.
Voller Empathie und mit anrührender Komik erzählt Stephan Lohse in seinem Debütroman vom Aufwachsen Anfang der Siebzigerjahre, von Teenagernöten und dem Trost der Freundschaft. Vor allem aber erzählt er vom Mut und dem Einfallsreichtum eines Kindes, das seine Mutter das Trauern lehrt und ihr zeigt, dass das Glück, am Leben zu sein, auch noch dem größten Schmerz standhält.
Voller Empathie und mit anrührender Komik erzählt Stephan Lohse in seinem Debütroman vom Aufwachsen Anfang der Siebzigerjahre, von Teenagernöten und dem Trost der Freundschaft. Vor allem aber erzählt er vom Mut und dem Einfallsreichtum eines Kindes, das seine Mutter das Trauern lehrt und ihr zeigt, dass das Glück, am Leben zu sein, auch noch dem größten Schmerz standhält.

Stephan Lohse reiht sich in die recht große Gruppe schreibender Schauspieler ein. Sein Roman "Ein fauler Gott" ist ein höchst gelungenes Debüt.
Von Hubert Spiegel
Sieben Wochen lang überprüft eine Mutter Tag für Tag den Zustand eines Schulbrotes, das ihr achtjähriger Sohn in seinem Brotbeutel vergessen hat. Das Brot wird allmählich steinhart, die Kanten biegen sich auf, die Wurst schwitzt das Fett aus. Die Mutter nimmt das Brot aus dem Beutel, betrachtet es, dreht es womöglich ein wenig in ihren Händen, vielleicht betastet sie es auch hier und dort. Dann legt sie es zurück in den Brotbeutel. Am nächsten Tag wird sie es genauso machen. Ein abstruses Alltagsritual, das an die Stelle einer Gewohnheit tritt, die nun, da sie aufgegeben werden musste, wichtig und kostbar erscheint: Nie wieder wird sie ihrem Sohn ein Wurstbrot schmieren.
Stephan Lohses Debütroman "Ein fauler Gott" setzt einen Tag nach dem Tod des kleinen Jonas ein. Er starb im Krankenhaus, zehn Tage nachdem er mit anderen Kindern zusammen ins Schwimmbad gegangen war, wo er "die Sache" bekam, wie sein älterer Bruder Ben es ausdrückt. Vielleicht war es ein epileptischer Anfall, vielleicht auch etwas ganz anderes. Die Todesursache bleibt im Dunkeln, denn der Vater spricht sich gegen eine Obduktion aus. Ist es nicht vollkommen gleichgültig, woran ein Achtjähriger stirbt, bleibt nicht sein früher Tod ein empörender Bruch mit allen vermeintlichen Lebensgewissheiten, ganz gleich, was ihn verursacht hat? Wir müssen alle sterben, aber dürfen nicht zumindest Kinder für ein paar Jahre das Gefühl der Unsterblichkeit genießen? Für Ruth, die Mutter von Jonas und Ben, wird die Frage nach der Todesursache im Laufe der Zeit immer wichtiger. Ein Tod ohne benennbare Ursache ist noch sinnloser als sinnlos.
Der Sarg von Jonas ist mit einem Engel geschmückt. Er soll, so flüstert Ruth Ben ins Ohr, die Familie daran erinnern, dass "der liebe Gott einen Engel gebraucht hat. Und dafür hat er sich Jonas ausgesucht." Fauler Gott, denkt Ben. Fauler Kackgott.
Stephan Lohse, 1964 in Hamburg geboren, hat Schauspiel am berühmten Max-Reinhardt-Seminar in Wien studiert und unter anderem am Hamburger Thalia Theater, an der Schaubühne in Berlin und am Wiener Schauspielhaus auf der Bühne gestanden. Im Sommer des Jahres 1972, in dem die Romanhandlung beginnt, war Lohse etwa so alt wie Jonas zum Zeitpunkt von dessen Tod. Der Bruder Benjamin, genannt Ben, ist drei Jahre älter und von nun an allein mit seiner Mutter Ruth, denn Vater Hans ist von Hamburg nach Frankfurt gezogen, wo er mit seiner neuen Frau zusammenlebt. Aus einer ganz normalen vierköpfigen Familie ist innerhalb kurzer Zeit ein zweiköpfiger Familientorso geworden, geplagt von Trauer und Phantomschmerz. Ben ist der Restsohn, das kümmerliche Bisschen, das übriggeblieben ist, ein stilles, zurückhaltendes, auf schräge Weise versponnenes Kind, das sich manchmal in seine Traumwelt zurückzieht, in der es sich in ein roboterartiges Wesen verwandelt, eine "anorganische Menschenmaschine", deren Augenblinzeln zum Beispiel durch "Relaistasten in seinen Schläfen" ausgelöst wird. Aber der Tod des kleinen Bruders bringt sogar die Menschenmaschine durcheinander: "Neuerdings muss er jedes Mal, wenn er einatmen will, ein Gegengewicht über eine Zuganlage anheben lassen. Gibt er den Befehl zum Anheben zu spät oder vergisst ihn, kriegt er keine Luft mehr. Dann müssen zum Ausgleich die Ventile zum Seufzen geöffnet werden, was ziemlich anstrengend ist."
Manchmal vergisst seine Mutter, wie jung Ben noch ist, viel zu jung jedenfalls, um zu verstehen, dass auch sie noch nicht alt ist. Während Ben in der Schule mit Chrisse, dem Sohn der Französischlehrerin, die tatsächlich eine echte Französin ist, einen Freund gewinnt, erste erotische Erfahrungen sammelt, erst mit Chrisse, danach beim Engtanzen mit Dagmar, von einem "Herrenrad" mit Dreigangschaltung träumt und im ausrangierten Opel, der im Garten des ein wenig seltsamen Herrn Gäbler vor sich hin rostet, lernt, wie man kuppelt, schaltet und den Blinker setzt, kämpft Ruth mit zunehmender Verzweiflung darum, vor Trauer, Schmerz und Einsamkeit nicht den Verstand zu verlieren. Oder ihn zumindest nicht so zu verlieren, dass Ben etwas davon mitbekommt: "Mami geht zum Weinen in ihr Schlafzimmer. Sie denkt, dass Ben sie dort nicht hört. Doch Ben hört alles. Er hört ihr murmelndes Schluchzen, das Zittern in der Luft, wenn sie nach Atem ringt, ihr Schniefen, während sie ein Taschentuch sucht, er hört ihr Wimmern,wenn sie auf ,Nein' weint oder auf ,O Gott' oder auf ,Bitte nicht'. Er hört, wenn sie müde wird und still und sich schnäuzt und ,Gut jetzt' sagt und aufsteht und aus dem Schlafzimmer kommt und mit ihrem Leben weitermacht. Auf der Treppe sagt sie: ,Du bist schon da?'"
Souverän wechselt Lohse zwischen den Perspektiven von Ben und seiner Mutter, deren Kindheit in einigen Rückblenden skizziert wird. Das Aroma der siebziger Jahre wird stilsicher heraufbeschworen, aber nicht überstrapaziert. Lohse ist ein ökonomischer, bei aller Einfühlung in die Verästelungen der Trauer auch diskreter Erzähler, der das Stilmittel der erlebten Rede bei Mutter und Sohn souverän einzusetzen versteht und beiden Figuren ihre Würde und kleinen Geheimnisse belässt.
Dass der frühe Tod eines Kindes die Lebenserwartung der Eltern reduzieren kann und die Suizidgefährdung vor allem der betroffenen Mütter deutlich erhöht, ist aus der Forschung über das Phänomen des Kindstodes bekannt. Auch Ruth ist stark selbstmordgefährdet. In einem alten Konversationslexikon liest sie unter dem Stichwort "Lebensgeister" nach, was sie verloren hat.
Stephan Lohse erzählt eine seltsam schwebende Geschichte von Trauer und Verlust, von den wundersamen Abenteuern der Kindheit und davon, wie ein Sohn und eine Mutter in Schmerz und Hilflosigkeit zueinanderfinden. Sein Roman ist einfühlsam, aber niemals kitschig, anrührend und humorvoll und zeugt von großem Gespür für sprechende Details. Ein schönes, ein beeindruckendes Debüt.
Stephan Lohse:
"Ein fauler Gott".
Roman.
Suhrkamp Verlag,
Berlin 2017. 330 S., geb.,
22,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Lohses Roman steckt voller Trauer und Verlust, er ist anrührend, aber gänzlich kitschfrei ... « Gerrit Bartels Der Tagesspiegel 20170623