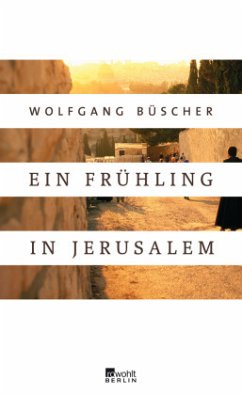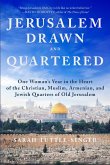Wolfgang Büscher in Jerusalem: Zwei Monate hat er in der Altstadt gelebt, erst in einem arabischen Hostel am Jaffator, dann in einem griechischen Konvent aus der Kreuzritterzeit. Er war einfach da, und doch hat er sich auf fast zweitausend Jahre alten Spuren bewegt - schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus gingen Europäer nach Jerusalem, um eine Weile zu bleiben oder sogar ganz. Büscher bewegt sich durch die Räume, den Widerhall dieser zweitausend Jahre. Ein Ort, aufgeladen mit Religion, Prophetie, Politik. Früh um fünf auf dem Ölberg stehend, kann man es hören und sehen - erst die Muezzins, dann die Glocken, dann das erste Sonnenlicht auf der goldenen Kuppel des Felsendoms.
In all das taucht Büscher ein. Er hört Jerusalem zu, nimmt seine Bilder und Stimmen auf, dringt immer tiefer ein in die Geheimnisse der Stadt. Verbringt die Tage im arabischen, christlichen, jüdischen Viertel, in den halbdunklen Gassen und Souks, auf der Via Dolorosa, an der Klagemauer und in Gewölben, in denen arabische Männer Kardamomkaffee trinken und Wasserpfeife rauchen. Er läuft durchs Kidrontal, durch den Garten Gethsemane, wandert über das Dach von Jerusalem und läßt sich eine Nacht lang in der Grabeskirche einschließen. Ein Frühling in Jerusalem: eine einzigartige Reise in eine unerschöpfliche Vergangenheit, in eine faszinierende Gegenwart.
In all das taucht Büscher ein. Er hört Jerusalem zu, nimmt seine Bilder und Stimmen auf, dringt immer tiefer ein in die Geheimnisse der Stadt. Verbringt die Tage im arabischen, christlichen, jüdischen Viertel, in den halbdunklen Gassen und Souks, auf der Via Dolorosa, an der Klagemauer und in Gewölben, in denen arabische Männer Kardamomkaffee trinken und Wasserpfeife rauchen. Er läuft durchs Kidrontal, durch den Garten Gethsemane, wandert über das Dach von Jerusalem und läßt sich eine Nacht lang in der Grabeskirche einschließen. Ein Frühling in Jerusalem: eine einzigartige Reise in eine unerschöpfliche Vergangenheit, in eine faszinierende Gegenwart.

Das Buch zur Stunde? Der Reiseschriftsteller Wolfgang Büscher ist zum ersten Mal ortsfest, um sich ganz auf die heilige Stadt der drei Weltreligionen einzulassen. Das Ergebnis liegt jenseits der Tagespolitik und birgt kleine Wunder.
Von Hannes Hintermeier
Mit einer selten gewordenen Beharrlichkeit geht Wolfgang Büscher seiner Wege. Die führen ihn seit 1998 als Buchautor in die unterschiedlichsten Weltgegenden. Einmal ging er zur Fuß von Berlin nach Moskau und wurde mit dem Bericht über diese Wanderung berühmt, dann umrundete er Deutschland entlang der Grenzen und fand heraus, dass die Trennung des Landes viel weniger mit den Gegensätzen zwischen West- und Ostdeutschen als mit jenen zwischen Norden und Süden zu tun hat. Sein Erfolg blieb nicht ohne Folgen - er hat eine ganze Wandergruppe von schreibenden Nachahmern auf den Plan gerufen.
Der 1951 im Nordhessischen geborene, seit langem in Berlin lebende Alleingänger durchstreifte danach das fernere Asien und übertraf sich selbst, als er in "Hartland" (2010) von Kanada immer nach Süden durch die Vereinigten Staaten lief - durchs Herzland. Im Autofahrerland als Fußgänger auf Landstraßen unterwegs zu sein, das machte ihn zum permanent verdächtigen Subjekt.
Jetzt hat sich Büscher, mittlerweile jugendliche dreiundsechzig Jahre alt, einen Traum erfüllt. Indem er nicht irgendwohin ging, sondern Anfang dieses Jahres zwei Monate einen guten Quadratkilometer abschritt und erkundete. Er saß und schaute auf Jerusalem, die heilige Stadt dreier Weltreligionen. Den vor siebentausend Jahren erstmals besiedelten, felsigen Fleck Erde, der in dieser langen Geschichte so viele Eroberungen zählte wie wohl keine andere Stadt. Und zu dem zu allen Zeiten Pilger aufbrachen.
Heute hat die Stadt achthunderttausend Einwohner, die religiöse Vielfalt umfasst Juden aller Schattierungen und Glaubensrichtungen, dazu Sunniten, Schiiten, Alawiten, Drusen, Römisch-Katholische, evangelische Christen, Anglikaner, Armenier und Orthodoxe aus Russland, Syrien, Griechenland, Georgien. In vier Segmente ist die historische Altstadt geteilt, das jüdische, armenische, christliche und muslimische Viertel. Die Zahl der Synagogen übersteigt mit mehr als 1200 die Zahl der Kirchen und Moscheen um ein Vielfaches. Aber eine Lösung, wie man diesen hochbrisanten Ort entschärfen könnte, ist nicht in Sicht. Die letzte Intifada der Palästinenser liegt vierzehn Jahre zurück; eine neue, dritte, scheint derzeit nicht unwahrscheinlich. Es brennt schon wieder, Anschläge wie der auf die Synagoge vor knapp zwei Wochen lassen selbst bei zuversichtlichen Beobachtern Zweifel aufkommen, ob es jemals Frieden werden wird in dieser Stadt.
Das Feld ist an sich gut bestellt, an Büchern über Jerusalem mangelt es nicht; das im angelsächsischen Buchmarkt beliebte Genre der Stadt-Biographie hat zuletzt Simon Sebag Montefiore (F.A.Z. vom 26. November 2011) bespielt. Um eine kulturgeschichtliche Fleißaufgabe geht es Wolfgang Büscher gerade nicht, er liefert kein dickes Kompendium mit Bildern, Karten, Fußnoten und Bibliographie. Seine Bücher sind Meilensteine der Gattung "erzählendes Sachbuch", ein Genre, das mächtig aufgeholt hat, in dem es aber auch mächtig viele verkappte Autobiographien gibt.
Wolfgang Büscher setzt dagegen den Blick des erfahrenen Reporters, der seine Anschauung durch Faktenchecks, historische Recherche und viele Gespräche ergänzt, filtert, objektiviert. Die Methode des genauen Hinsehens ist ein Verfahren, das durch die Bilderflut des Fernsehens und des Internets in den Hintergrund gedrängt wird. Gerade an einem Ort wie Jerusalem, in dem die historische Zeit niemals vergangen ist, sondern geschichtliche Ereignisse von vor zweitausend Jahren die Gegenwart bestimmen, bietet es sich aber an, weil die schnelle Scheinobjektivität der Kamera selten belastbare Einsichten generiert.
Sein erster Stadtführer, den Büscher Charly Effendi nennt, ist Armenier. Er lacht den Neuankömmling aus, als der ihm sagt, er sei gekommen, Jerusalem zu verstehen. Das sei ihm nach sechzig Jahren nicht gelungen, aber eins wisse er mittlerweile: "There is no joy in this city."Büscher ist nicht zum ersten Mal in der Stadt, aber die Aussicht auf einen intensiven Aufenthalt versetzt ihn in angespannte Vorfreude, als ihn das Sammeltaxi am Jaffator absetzt. Dort wird er in einem schäbigen Hostel die ersten Wochen verbringen. Schon seine Ankunft gleicht einer biblischen Szene in Schwefelgelb, und tatsächlich droht Büschers gewohnte Lakonie einem biblischen Ton Platz zu machen; zum Glück nur vorübergehend.
Mehr als hundertmal wird die Stadt im Neuen Testament erwähnt, stets ist sie Zielort; der Koran nennt sie nicht, gleichwohl sie nach Mekka und Medina seine drittheiligste Stätte ist. Das klingt immer ein wenig nach Religionsquartett; und prompt gibt ihm der Taxifahrer noch ein Suchrätsel mit. "Akedah", der Titel eines Liedes spanischer Sepharden aus dem zwölften Jahrhundert, sei ein Schlüsselwort, um das Leben in dieser zerrissenen Stadt zu begreifen. Es wird eine Weile dauern, bis sich dem Autor der Sinn dieser Vokabel erschließt.
Über sich selbst gibt Büscher - wie in allen seinen Büchern - nur sehr dosiert Auskunft. Dass er seine probaten maßgearbeiteten Wanderschuhe trägt, dass er sich einen Janker mit Hirschhornknöpfen zugelegt hat; das sind nur Äußerlichkeiten eines Besuchers, der es eher auf Unsichtbarkeit anlegt. Einmal erwähnt er ein Prepaid-Handy, ob er Kontakt zu seiner Familie hält, Zeitungen liest, deutsche Fernsehnachrichten sieht, spielt keine Rolle: Er will sich ganz einlassen auf den Rhythmus, die Geräusche, die Demarkationslinien, auch auf die Spiritualität. Die Stunde seiner wahren Empfindung bleibt Privatsache.
So sitzt er stundenlang vor der Grabeskirche, bringt einmal sogar eine ganze Nacht in ihr zu. Er beobachtet die Pilger am Tempelberg, patrouillierende Polizei, Rekrutenvereidigungen, deutsche Touristen, amerikanische Priester, schlendert durch die Basare, wo man ihn alsbald wiedererkennt und in Ruhe lässt. Nach dem Schauen kommt das Nachdenken, die Phase, in der Büscher zu durchdringen sucht, was er wahrgenommen hat. Der große Reisende Christoph Ransmayr hat zuletzt in seinem "Atlas eines ängstlichen Mannes" ein jedes seiner kurzen Kapitel mit der Formulierung "Ich sah..." eingeleitet. Diese Technik findet bei Büscher ein Echo ("Ich sah, wo ich war"), und doch ist sie kein Abklatsch, sondern geistige Verwandtschaft. In Ransmayrs Roman "Die letzte Welt" über die Metamorphosen des Ovid werden mythologische Figuren zu realen Romanfiguren; Büscher dreht das Verfahren um: Er erkennt in real existierenden Taxifahrern, Pilgern, Devotionalienhändlern Gestalten aus Romanen von Dostojewskij, öfter aber noch Figuren der Bibel. Und einmal, auf dem Tempelberg, erlebt er eine Überhöhung der besonderen Art.
Einer der griechischen Mönche, die das Privileg haben, die Grabeskirche zu bewachen, ein wilder, schwarzer Hüne, ein Rausschmeißer, der erbarmungslos gegen Pilger vorgeht, die sich an der Schlange vorbeistehlen wollen, fixiert einen Gottesnarren. Einen offensichtlich verwirrten Asiaten, der verhaltensauffällig wird und mit allen Verrenkungen und Tricks möglichst schnell ans Grab will. Der Reporter erwartet einen Fausthieb, einen Rauswurf der Sonderklasse, doch es kommt anders: "Der Gottesnarr wollte ans Grab, alles andere war ihm vollkommen gleichgültig. Er bettelte, demütigte sich, achtete nicht darauf, ja bemerkte nicht mal, wie viele ihn anstarrten, es fehlte nur noch, dass er den Grabeswächter anmaunzte wie ein Kätzchen."
Aber anstatt den verrückten Mann vor die Tür zu setzen, tut der Mönch das Unerwartete: Er umarmt ihn, küsst sein Haar, lässt ihn ans Grab gehen, vor allen anderen. Aus dieser Szene schließt Büscher: "Eben war ich Zeuge von etwas geworden, wie es die Apostel in ihren Berichten alle paar Seiten erzählten - einer gleichnishaften Szene, absolut alogisch, unberechenbar, frei. Ein Akt der Liebe. Ich hatte die Uraufführung eines Gleichnisses gesehen, das nicht geschrieben stand."
Es sind Passagen wie diese, in denen sich die Klasse Büschers zeigt. Das hat auch mit der eingangs erwähnten Hartnäckigkeit und Ernsthaftigkeit zu tun. Und mit dem Einfühlungsvermögen, mit dem der Reporter Einheimische befragt, die ihm ihre Familiengeschichten erzählen. Die vornehme Mrs. Nora, der Franziskanermönch Paulus, der Grieche Dr. John, der ein Buch verfasst hat mit dem Titel "I am Jerusalem", der Rabbi mit dem deutschen Namen, der seine Reserve gegenüber einem Deutschen nicht überwinden will. Auschwitz kommt spät in diesem Buch, aber natürlich holt es den Autor ein.
Alle haben lange Vergangenheiten, und alle verwenden entschieden zu oft Possessivpronomina: meine Stadt, meine Religion, mein Haus, meine Familie. Die Stadt ohne Freude verliert jedes Jahr Menschen, die es nicht mehr aushalten dort; die den Glauben an eine politische Lösung ebenso wie die Hoffnung auf eine wirtschaftlich stabile Zukunft verloren haben. Dabei sind die Christen offenbar besonders saumselig, wie ein Muslim, Hotelier und Mitglied einer vornehmen Familie, klagt. Die Christen hätten Jerusalem vergessen, sie kümmerten sich lieber um Afrika, um Entwicklungshilfe - anstatt ihre Rechte in der Stadt geltend zu machen, in der Jesus lebte und starb.
Das unterscheidet sie von den Juden, deren "Akedah", deren Bindung an den Platz des ersten Tempels so stark ist, dass sie mühelos den Anfechtungen der Zeit und ihres Verrinnens widersteht: Brauchen die Juden überhaupt noch den Tempel, nach bald zweitausend Jahren? Mit dieser Frage geht Büscher auf seinen letzten und intellektuell potentesten Gesprächspartner los, den Rabbi mit dem deutschen Namen - "ein gesetzestreuer Jude, der seine Intelligenz nicht dazu benutzte, das Gesetz der Väter für seine Bedürfnisse zurechtzukneten". Und der erteilt ihm prompt eine Lektion in moderner Orthodoxie, dem geistigen Fundament einer erstarkenden nationalreligiösen Bewegung. Die Siedler und ihre militanten Auftritte lässt Büscher für sich selbst sprechen, ebenso wie eindimensional auf Gewalt setzende Reaktionen der Palästinenser.
Hätte dieses Buch mehr wollen können, mehr wollen müssen, ist die Selbstbescheidung auf das Format einer großangelegten Reportage zu kurz gegriffen? Der Aufenthalt hat den Autor verändert, er dankt im Abspann sogar der Stadt. Aber Wolfgang Büscher weiß, dass er als Berichterstatter nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Lesern gegenüber verpflichtet ist, Ausgewogenheit herzustellen. Auch wenn man ihm bedeutet, es sei unmöglich, zu Jerusalem keine Haltung zu entwickeln, bleibt doch stets die Gefahr, sich an diesem politisch so brisanten Pulverfass die Finger zu verbrennen. Einer expliziten Prognose enthält sich das Buch, aber ein Grundton der Sorge durchzieht die Seiten unübersehbar.
Wie schlecht es derzeit schon wieder um die Stadt steht, belegen die Nachrichten. Jerusalem als "Zünder" und den Tempelberg als "Lunte" zu beschreiben, mag als Bild zunächst plakativ wirken. Aber nach Lage der Dinge ist der Frieden dort nicht nur in weite Ferne gerückt, sondern erscheint einmal mehr als das, was er stets war - eine Ausnahme, ein vorübergehendes Geschenk. Monsieur Michel, der levantinische Ikonen- und Goldhändler, sagt es dem Besucher aus Deutschland zum Abschied voraus: "Es wird Krieg geben. So viele Jahrhunderte hatten wir keine Religionskriege, seit den Kreuzrittern nicht, aber es wird wieder welche geben, denken Sie an meine Worte, Monsieur."
Wolfgang Büscher: "Ein Frühling in Jerusalem".
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2014. 240 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit Wolfgang Büscher Jerusalem verstehen, das ist eine Aufgabe, der sich Rezensent Hannes Hintermeier mit Freude stellt, kennt er den Autor doch als beharrlich schauenden reisenden Reporter, der seinen Lesern Erkenntnisse vermittelt, die auf gründlicher Recherche, objektivierenden Gesprächen und genauem Hinsehen beruhen. Wenn Büscher zwei Monate Jerusalem bucht, horcht Hintermeier auf. Enttäuscht wird er nicht, auch wenn sich mitunter ein biblischer Ton in den Text einschleicht. Im Ganzen, versichert der Rezensent, bietet Büscher schöne Lakonie und wenig Selbstreflexion, dafür umso mehr einfühlende Beobachtung und Nachdenken. So, erklärt der Rezensent, lassen sich Vergleiche von gewöhnlichen Taxifahrern mit Figuren von Dostojewski und sogar biblische Gleichnisse ertragen, nein genießen, auch wenn Jerusalem am Ende doch ein Rätsel bleibt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Büscher hat gute Aussichten, einmal zu den Klassikern der Reiseliteratur zu zählen, noch vor Bruce Chatwin. Süddeutsche Zeitung