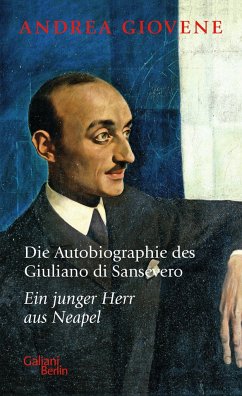Ein literarischer Schatz wird gehoben. Andrea Giovenes Romanserie Die Autobiographie des Giuliano di Sansevero - entdeckt und übersetzt von Moshe Kahn
Giuliano di Sansevero wächst auf in der verfallenden Pracht der Paläste seiner Vorfahren; während des Aufenthalts in einer nahe bei Neapel gelegenen Klosterschule bricht der Erste Weltkrieg aus. Im Schatten des Krieges und in der turbulenten Zeit danach erwachen im jungen Giuliano die Liebe zu den Büchern, das Interesse am weiblichen Geschlecht - und die Neugier auf die Welt.
Giuliano di Sansevero wächst auf in der verfallenden Pracht der Paläste seiner Vorfahren; während des Aufenthalts in einer nahe bei Neapel gelegenen Klosterschule bricht der Erste Weltkrieg aus. Im Schatten des Krieges und in der turbulenten Zeit danach erwachen im jungen Giuliano die Liebe zu den Büchern, das Interesse am weiblichen Geschlecht - und die Neugier auf die Welt.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Dass Andrea Giovenes vor mehr als fünfzig Jahren publizierte Romanreihe um den jungen Adligen Giuliano di Sansevero nun auch auf Deutsch erscheint, ist für Rezensent Tim Caspar Boehme ein Anlass zur Freude. Gespannt verfolgt er die genauen, mal nüchternen, mal ironisch gebrochenen Schilderungen aus dem Leben des Heranwachsenden, die von eigenen Erfahrungen des Autors inspiriert sind, die sich um Giulianos Erlebnisse im Kloster, aber auch um Familien- und Zeitgeschichte drehen. Dass auch der aufkommende italienische Faschismus nicht ausgespart wird und die Handlung um die oft mit charakterlichen Schwächen ausgestatteten Familienmitglieder erstaunlich wenig Adelsdünkel enthält, überzeugt den Rezensenten noch zusätzlich. Der "introspektive Tonfall" ist gewöhnungsbedürftig, räumt er ein, aber die Lektüre unbedingt lohnenswert, ist sein Fazit.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Andrea Giovene legt mit der "Autobiographie des Giuliano di Sansevero" eine frühe Form der Autofiktion vor
Metzlers "Italienische Literaturgeschichte" kennt ihn nicht. Eigentlich ein zuverlässiges Werk . . . Auch in der "Geschichte der italienischen Literatur" von Manfred Hardt folgt auf "Giovanni Fiorentino, ser" im Namenverzeichnis "Giraldi Cinzio, Giovan Battista". Nirgends ein Andrea Giovene. Selbst ein italienischer Band zur Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts löst das Problem nicht. Gut, er ist schmal - aber eben passgenau. Ein Autor, in gedruckten Nachschlagewerken verzweifelt gesucht, das ist schon mal ein guter Köder.
Damit nicht genug. Die Zeit, die Andrea Giovene in seiner "Autobiographie des Giuliano di Sansevero" abhandelt, umfasst die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Märsche und Maschinen, Faschismus und Futurismus, Preisexplosion und Perlwein. Kriege, Revolutionen, Umstürze. Turbulenter geht es kaum, der Autor schöpft aus dem Vollen und schickt seine Figur durch halb Europa, zunächst von Neapel nach Mailand, Paris natürlich als erste außeritalienische Station, aber auch Deutschland und die Niederlande, als Begleiter peruanischer Touristen und als Soldat in Krieg wie Gefangenschaft. Die Möglichkeiten, die sich Giovene zum Zeitporträt, mehr aber noch zur Deutung bieten, sind enorm. Aufkommende totalitäre Ideologien, Kunst und Kultur, die vielfach glaubten, alles schon zu kennen, und daher verzweifelt nach Neuem Ausschau hielten, die teils endgültige Überwindung monarchischer Staatsformen - der Köder ist nicht gut, er ist delikat.
Damit zu dem, was der Übersetzer Moshe Kahn und Ulrike Voswinckel als Benachworterin des ersten von insgesamt fünf Bänden an der Angel haben. In der "Autobiographie" schildert Giuliano, Spross eines alten neapolitanischen Adelsgeschlecht, Jahrgang 1903, sein bewusst erlebtes Leben. Der erste Band setzt ein, als er neun Jahre alt ist und den nicht nur metaphorisch von Schimmel befallenen Stammbaum in einem der Salons betrachtet. Die Zweige liegen schon zu weit oben unter der Zimmerdecke, für seinen eigenen Namen scheint buchstäblich kein Raum mehr. Bildsprachlich ist der Einstieg großartig.
Sprachlich herrscht von Anfang an Klarheit: "Durch diese Machenschaften waren eine nicht näher bestimmbare Zahl von Besitztümern und Lehen - darunter einige von gewaltiger Größe - bereits zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts auf eine geringe Zahl geschrumpft, und dann wirkten noch sozusagen schicksalhafte Umstände mit, wie der frühzeitige Tod, nicht geschäftsfähige Minderjährige, entmündigte Alte oder Hitzköpfe, die in den napoleonischen Wirren zu Schaden gekommen waren, den Auflösungsprozess zu vervollständigen." Sätze dieser Länge sind keine Ausnahme, im Gegenteil. Klugerweise fällt Giovene auch in der Rückschau nicht in den Ton des Kindes, bedauerlicherweise nutzt er aber auch das Wissen des Erzählers nicht, um vorausgreifender oder kommentierender darzustellen. So reizvoll sich der altfränkische Stil gerade im Kontrast zu den rasanten Umbrüchen der damaligen Zeit ausnimmt, er soll dem Werk zum Verhängnis werden.
Nicht nur, dass der Ton unverändert bleibt. Von den fünf Bänden der "Autobiographie", insgesamt knapp zweitausend Seiten, liegen nun drei Bände auf Deutsch vor, die beiden hier besprochenen bei Galiani erschienenen sowie der dritte Band, 2010 bei Osburg herausgekommen und ebenfalls in dieser Zeitung rezensiert. Mehr als die Hälfte also des auch in Italien in Einzelbänden veröffentlichten Werks. Klostererziehung, Erster Weltkrieg, erste Berufserfahrung im Ausland und die Rückkehr nach Italien. Genug, um auf guter Grundlage auch für die deutsche Version zu sagen: Der Ton trägt nicht.
Der Autor hat seinen Ich-Erzähler ein Jahr früher zur Welt kommen lassen als sich selbst und ihn mit etlichen Parallelen in Herkunft und Lebensstationen - Internat, Auslandsaufenthalte, Kriegsgefangenschaft - ausgestattet. Der Begriff der Autofiktion ist durchaus angemessen. Moshe Kahn hat Giovene kurz vor dessen Tod persönlich kennengelernt und ihm versprochen, sich für eine Übersetzung ins Deutsche einzusetzen. Er zeigt sich beeindruckt von der "Lebendigkeit" des Mannes. Das mag den Blick auf das Werk prägen. Zwar verliert Giuliano noch als Junge seine einstige Fügsamkeit, an deren Stelle "eine anmaßende Geisteshaltung trat, und das bilderstürmerische Verhalten gegenüber den Ahnenbildern und dem Stammbaum wurde von Fragen und Beobachtungen begleitet, die man als unpassend empfand". Der Aufmüpfigkeit gesellt sich etwas hinzu, das sich mit dem heutigen Begriff der "Wohlstandsverwahrlosung" fassen lässt. Der Erzähler wird zum Außenseiter und damit eigentlich zum idealen Beobachter.
Ihm könnte zupasskommen, dass er keine Vorurteile hat, doch seiner Rolle wird er nicht gerecht. Vielleicht funktioniert das treidelnde Beobachten ohnehin besser mit Figuren vom anderen Ende der sozialen Leiter, mit einem Simplicius Simplicissimus oder einem Josef Schwejk, vielleicht scheitert Giovene aber auch, weil er seinen Giuliano ohne Aufgeschlossenheit gestaltet. Die Selbstreflexionen des Ich-Erzählers stehen in krassem Ungleichgewicht zu den äußeren Verhältnissen. Die politischen und geschichtlichen Entwicklungen werden völlig beliebig. Dem Erzähler fehlt jede Triebfeder, die sich bei den Figuren der anderen Werke erkennen lässt. "All diese Dinge, all diese Personen hatten jedoch nichts mit mir und meinem eigentlichen Ich zu tun, sie waren lediglich Ablenkungen, allerdings unverzichtbar für ein so einsames Leben wie das meine." Moshe Kahn verwehrt sich explizit gegen den Vergleich Giovenes mit Marcel Proust oder Giuseppe Tomasi di Lampedusa, thematisch und strukturell drängen sich die "Suche nach der verlorenen Zeit" und der "Leopard" jedoch genau dafür auf.
Gleichsam ex negativo ließe sich ja das Porträt auch eines unzuverlässigen Erzählers erstellen, der seinen "Mangel an Interesse für das politische Leben und für alles, was in unmittelbarem Zusammenhang damit stand", offen bekennt. Er könnte aus den Zeilen als Typus heraustreten, als Untertan beispielsweise, als Figur, die Aufschluss darüber gibt, was den Autor in der Rückschau bei der künstlerischen Ausformung seines Materials geleitet haben mag. Moshe Kahn und Ulrike Voswinckel erkennen da einiges, sprechen von der "Empathie" des Erzählers, der "sein humanistisches Credo in erniedrigenden und lebensbedrohlichen Situationen zu erhalten" sucht. Giuliano selbst sieht das keineswegs so. Als seine Geliebte ihm mitteilt, sie sei schwanger, reagiert er kalt: "Mir wurde klar, dass ich nicht mitleidvoll war, vielleicht sogar nicht einmal menschlich. Doch wenn ein Mensch Herr seiner Handlungen und verantwortlich für seinen Willen ist, so ist er es weder in seinen Gefühlen noch in seinen Trieben. Nichts von dem, was ich über das Gefühl der Vaterschaft gehört hatte, traf auf mich zu, jetzt, als ich vor ihr stand. Sicher war, dass ich sie nicht liebte." Folglich geht er seiner Wege.
Diese Stelle entstammt dem zweiten Band, als der Erzähler bereits über dreihundert Seiten eingeführt ist. Ein Indiz, von einem weichen Kern unter harter Schale auszugehen, gibt es kaum noch. Giovene hat seine "Autobiographie" zunächst auf eigene Kosten veröffentlicht, dann einen Verlag in Italien gefunden, ehe er auch dort wieder in Vergessenheit geraten ist. Diesen Umstand räumen Kahn wie Voswinckel ein. Anfang der Siebzigerjahre, da sind sich beide einig, in einer Zeit mit ökonomischen Krisen, linkem Aufwind und literarischen Experimenten, sind für Giovene und sein Werk keine Erfolge zu erzielen. Neben der nachrangigen Frage, ob damit indirekt die Gruppe 63, der auch Umberto Eco angehörte, für das Scheitern Giovenes verantwortlich gemacht wird, bleibt die vorrangige, wieso es bei den vielen Regierungen in Italien dann nicht auch eine echte Hochphase für Giovene gegeben hat. Warum ist er nie zurück aus der Versenkung gekommen? Buchgestalterisch sind die deutschen Bände gelungen, editorisch weniger: Wenn schon Anmerkungen, dann mehr. Wer sind Francesco Mastriani oder Matilde Serao? (Beide auch in Vergessenheit geraten, zu Recht im Übrigen, doch Serao findet sich in den eingangs erwähnten Werken.) So gibt es nicht unbedingt eine Wiederentdeckung zu feiern, wohl aber eine seltene Einmütigkeit von Literaturkritik, Literaturgeschichte und Publikumsgeschmack. CHRISTIANE PÖHLMANN
Andrea Giovene: "Die Autobiographie des Giuliano di Sansevero". Ein junger Herr aus Neapel.
Aus dem Italienischen von Moshe Kahn. Nachwort von Ulrike Voswinckel. Galiani Verlag, Berlin 2022. 304 S., geb., 26,- Euro.
Andrea Giovene: "Die Autobiographie des Giuliano di Sanseverero". Die Jahre zwischen Gut und Böse.
Aus dem Italienischen von Moshe Kahn. Galiani Verlag, Berlin 2022. 352 S., geb., 26,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Bei Galiani Berlin sind die ersten beiden Bände herausgekommen, die der Leserschaft in der wunderbar singenden und beschwörenden Übersetzung von Moshe Kahn erstmals dieses großartige Leservergnügen ermöglichen. Rolf Fath Badische Neueste Nachrichten 20230118
Dass Andrea Giovenes vor mehr als fünfzig Jahren publizierte Romanreihe um den jungen Adligen Giuliano di Sansevero nun auch auf Deutsch erscheint, ist für Rezensent Tim Caspar Boehme ein Anlass zur Freude. Gespannt verfolgt er die genauen, mal nüchternen, mal ironisch gebrochenen Schilderungen aus dem Leben des Heranwachsenden, die von eigenen Erfahrungen des Autors inspiriert sind, die sich um Giulianos Erlebnisse im Kloster, aber auch um Familien- und Zeitgeschichte drehen. Dass auch der aufkommende italienische Faschismus nicht ausgespart wird und die Handlung um die oft mit charakterlichen Schwächen ausgestatteten Familienmitglieder erstaunlich wenig Adelsdünkel enthält, überzeugt den Rezensenten noch zusätzlich. Der "introspektive Tonfall" ist gewöhnungsbedürftig, räumt er ein, aber die Lektüre unbedingt lohnenswert, ist sein Fazit.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH