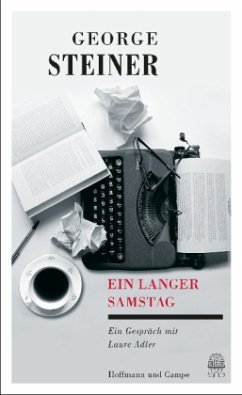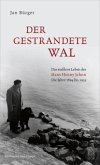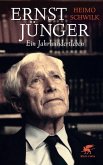George Steiner, der unnachgiebige Denker, polyglotte Intellektuelle und scharfzüngige Kritiker, gibt im Gespräch mit Laure Adler Einblick in sein Leben und Werk. Tief verwurzelt in der europäischen Kultur, wurde für den Sohn österreichischer Juden, die 1940 aus Paris nach New York flohen, eine Frage zum Angelpunkt seines Denkens: Wie konnte das zivilisierte, kultivierte Europa diese unvorstellbare Barbarei hervorbringen?
Als die Kulturjournalistin Laure Adler in einem englischen Garten zum ersten Mal George Steiner begegnet, weiß sie noch nicht, dass sie einen sehr langen Nachmittag miteinander verbringen werden: Über mehrere Jahre treffen sie sich immer wieder, um ihr Gespräch fortzusetzen. Steiner, als einer der letzten Benjaminschen Flaneure, rekapituliert das zwanzigste Jahrhundert. Seine Eltern fliehen vor dem wachsenden Antisemitismus in Wien nach Paris, 1940 schafft die Familie es gerade noch rechtzeitig, Frankreich in Richtung New York zu verlassen. Steiners Denken ist von seiner Biographie beeinflusst: seine Liebe für Sprache genauso wie seine Verachtung für die großen Mythen des vergangenen Jahrhunderts, die Psychoanalyse, der Marxismus und der Strukturalismus. Aber Steiner begleitet seine Leser nicht nur bravourös durch die Gedankenwelt des zwanzigsten Jahrhunderts, immer wieder kehrt er zu seiner großen Liebe, der Musik, zurück, die für ihn Ausdruck purer Lebenslust ist.
Als die Kulturjournalistin Laure Adler in einem englischen Garten zum ersten Mal George Steiner begegnet, weiß sie noch nicht, dass sie einen sehr langen Nachmittag miteinander verbringen werden: Über mehrere Jahre treffen sie sich immer wieder, um ihr Gespräch fortzusetzen. Steiner, als einer der letzten Benjaminschen Flaneure, rekapituliert das zwanzigste Jahrhundert. Seine Eltern fliehen vor dem wachsenden Antisemitismus in Wien nach Paris, 1940 schafft die Familie es gerade noch rechtzeitig, Frankreich in Richtung New York zu verlassen. Steiners Denken ist von seiner Biographie beeinflusst: seine Liebe für Sprache genauso wie seine Verachtung für die großen Mythen des vergangenen Jahrhunderts, die Psychoanalyse, der Marxismus und der Strukturalismus. Aber Steiner begleitet seine Leser nicht nur bravourös durch die Gedankenwelt des zwanzigsten Jahrhunderts, immer wieder kehrt er zu seiner großen Liebe, der Musik, zurück, die für ihn Ausdruck purer Lebenslust ist.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Weniger wie eine Besprechung, mehr schon wie eine Hommage und durchaus ein bisschen feierlich liest sich, was Rezensent Volker Breidecker zu diesem Gesprächsbuch schreibt. Nach ausführlicher Würdigung der Person und ihrer Verdienste kommt der Rezensent auch auf ein Thema zu sprechen, in dem vielleicht die Aktualität des Bandes zu finden ist: das "Nomadentum", das Steiner als eine für sich angemessene Existenzform ansieht. Und auf die Frage, wie "Fremde" zu behandeln seien, nämlich als Gäste. Wenn die Menschen nicht lernten, sich als Gäste und Gastgeber zu betrachten, so zitiert Breidecker den greisen Lehrer, werde es "zu schrecklichen ethnischen Konflikten und zu Religionskriegen kommen". Über die Gespräche sagt Breidecker nicht viel mehr, als dass sie auch als Denkbewegungen durch ein "Schlendern" und Umherstreifen" und eine glückliche Kunst der Abschweifung gekennzeichnet seien.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Eine graziöse Konversations-Promenade durch sein Leben.« Alexander Kluv Jüdische Allgemeine, 17.03.2016
Zunächst, so schreibt Mara Delius, sei sie skeptisch gewesen, ob sich ein Denker wie George Steiner überhaupt begreifen lasse anhand eines in Buchform gebrachten Gesprächs, wie es die französische Kulturjournalistin Laure Adler geführt hat. Die Kritikerin fürchtete gar eine "intellektuelle Homestory". Doch die Angst sei unbegründet gewesen, gibt Delius nach der Lektüre zu. Auf einen mit Anekdoten gespickten Abriss von Steiners Leben folge in dem schmalen Band die Aufforderung zum Rückzug ins Denken. Doch dabei sei der Philosoph und Kulturkritiker kein Mann der Intellektualismen, so Delius, seine Liebe zum Wort bleibe stets lebendig und lebensnah. So hat die Rezensentin dieses in ihren Augen "wohlkomponierte Gespräch" ganz offensichtlich mit großem Gewinn gelesen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH