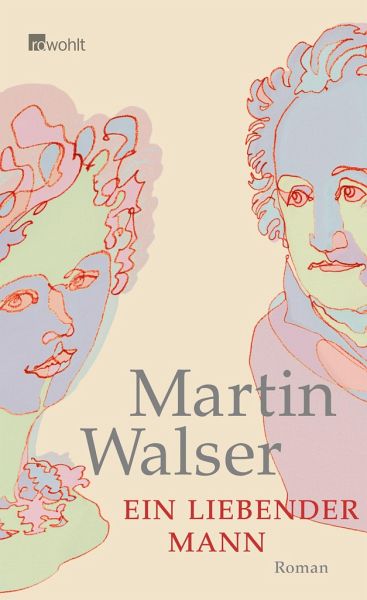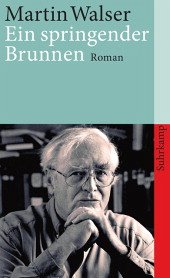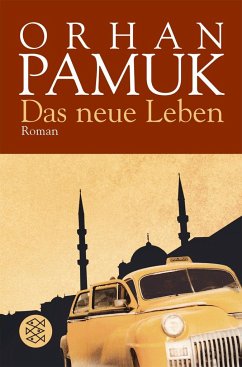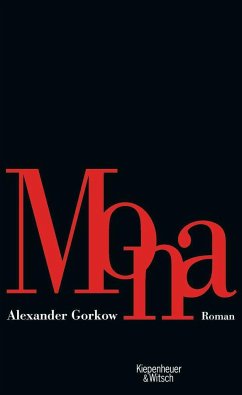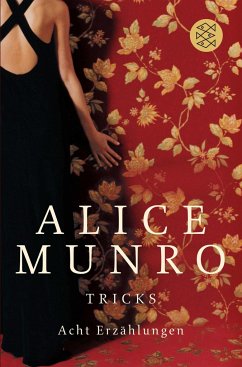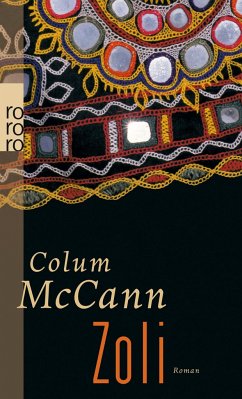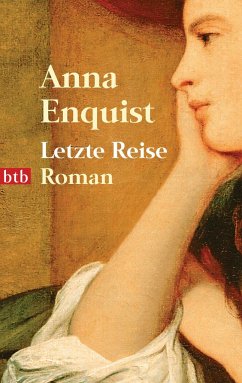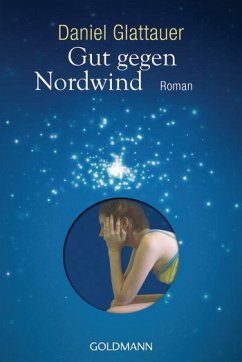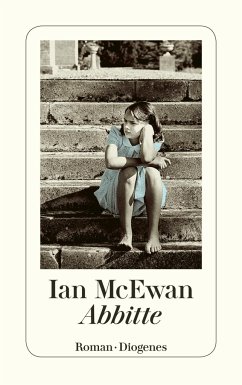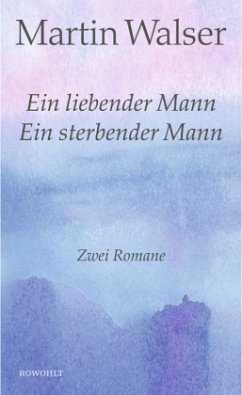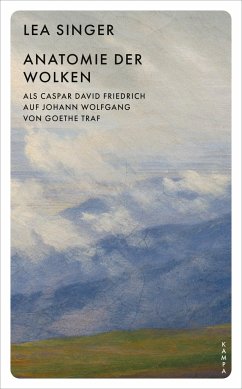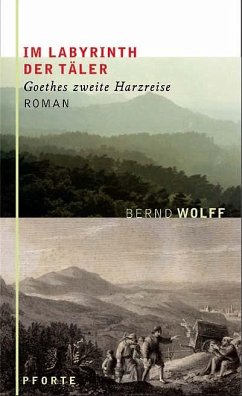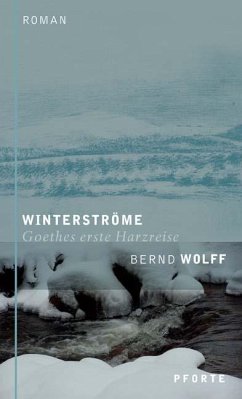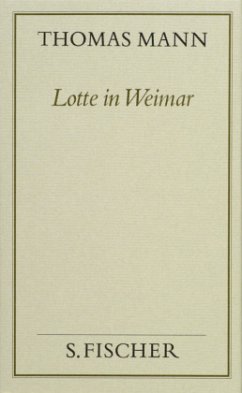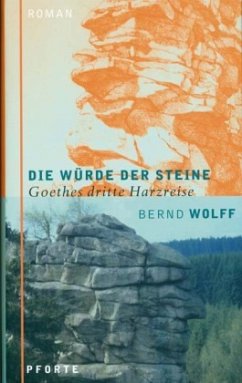Martin Walser
Gebundenes Buch
Ein liebender Mann
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Martin Walsers Roman über Goethes letzte Liebe - vielleicht sein größter überhaupt
Der 73-jährige Goethe - Witwer und so berühmt, dass sein Diener Stadelmann heimlich Haare von ihm verkauft - liebt die 19-jährige Ulrike von Levetzow. 1823 in Marienbad werden Blicke getauscht, Worte gewechselt, die beiden küssen einander auf die Goethe’sche Art. Er sagt: Beim Küssen kommt es nicht auf die Münder, die Lippen an, sondern auf die Seelen. «Das war sein Zustand: Ulrike oder nichts.» Aber sein Alter holt ihn ein. Auf einem Kostümball stürzt er, und bei einem Tanztee will sie ein Jüngerer verführen. Der Heiratsantrag, den er Ulrike trotzdem macht, erreicht sie erst, als ihre Mutter mit ihr nach Karlsbad weiterreisen will. Goethe, mal hoffend, mal verzweifelnd, schreibt die «Marienbader Elegie». Zurück in Weimar, lässt ihn die eifersüchtige Schwiegertochter Ottilie nicht mehr aus den Augen. Martin Walsers neuer Roman erzählt die Geschichte einer unmöglichen Liebe: bewegend, aufwühlend und zart. Die Glaubwürdigkeit, die Wucht der Empfindungen und ihres Ausdrucks - das alles zeugt von einer Kraft und (Sprach-)Leidenschaft ohne Beispiel.
Martin Walser, 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, war einer der bedeutendsten Schriftsteller der deutschen Nachkriegsliteratur. Für sein literarisches Werk erhielt er zahlreiche Preise, darunter 1981 den Georg-Büchner-Preis, 1998 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und 2015 den Internationalen Friedrich-Nietzsche-Preis. Außerdem wurde er mit dem Orden 'Pour le Mérite' ausgezeichnet und zum 'Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres' ernannt. Martin Walser starb am 26. Juli 2023 in Überlingen.

© Philippe Matsas/Opale
Produktdetails
- Verlag: Rowohlt, Hamburg
- Artikelnr. des Verlages: 17548
- 2. Aufl.
- Seitenzahl: 288
- Erscheinungstermin: 29. Februar 2008
- Deutsch
- Abmessung: 210mm x 134mm x 27mm
- Gewicht: 375g
- ISBN-13: 9783498073633
- ISBN-10: 349807363X
- Artikelnr.: 23333541
Herstellerkennzeichnung
Rowohlt Verlag GmbH
Kirchenallee 19
20099 Hamburg
produktsicherheit@rowohlt.de
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Tief bewegt zeigt sich Joachim Kaiser über den Roman eines berühmten alten Mannes über einen anderen berühmten alten Mann. Martin Walsers Goethe-Roman steckt für ihn übervoll mit "Erstaunlichem". Und ist gar nicht peinlich, wie Kaiser versichert, sondern anmutig in der Schilderung von Goethes später "Liebes-Passion" zu Ulrike von Levetzow. Walsers Sprachgewalt findet Kaiser hier auf ihrem Höhepunkt, die Darstellung inspirierter noch als in Thomas Manns "Lotte". So "authentisch geglückt" Goethes Passion durch "lebendigstes Zeitkolorit" und "Dichter-Gescheitheit" dem Rezensenten auch erscheint, so eindeutig ist es für ihn eine Schöpfung "Walser'scher Spiritualität, Bilder- und Übertreibungsfülle". Gut so, meint Kaiser, der dem Autor "sprachliche Anachronismen" und eine, wie er zu denken gibt, nicht unproplematische Drift hin zum "grimmigen Goethe-Essay" im Schlussteil durchgehen lässt. Lieber als ödes Historisieren ist Kaiser das allemal, zumal der Stil des Meisters eh "unerfindbar, unnachahmlich" sei.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Martin Walser erzählt in seinem neuesten Werk von der ungewöhlichen Liebesgeschichte zwischen dem 73-jährigen Goethe Witwer und der 19-jährigen Ulrike von Levetzow. Deswegen bin ich zunächst skeptisch an das Buch herangegangen, wurde aber sehr positiv überrascht. Walser …
Mehr
Martin Walser erzählt in seinem neuesten Werk von der ungewöhlichen Liebesgeschichte zwischen dem 73-jährigen Goethe Witwer und der 19-jährigen Ulrike von Levetzow. Deswegen bin ich zunächst skeptisch an das Buch herangegangen, wurde aber sehr positiv überrascht. Walser schreibt feinfühlig und zugleich ironisch, eine Mischung, die einen zum Nachdenken und Schmunzeln bringt.
Besonders für Goethe-Kenner ein Muss!
Weniger
Antworten 21 von 32 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 21 von 32 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
Martin Walser - der Gott der Göttlichen für die Einen, eine unbekannte Persönlichkeit für die Anderen. Ob man ihn kennt oder nicht ist egal. Man sollte nur wissen, dass er in seinem Roman "Ein liebender Mann" die Geschichte von keinem Anderen als Goethe …
Mehr
Martin Walser - der Gott der Göttlichen für die Einen, eine unbekannte Persönlichkeit für die Anderen. Ob man ihn kennt oder nicht ist egal. Man sollte nur wissen, dass er in seinem Roman "Ein liebender Mann" die Geschichte von keinem Anderen als Goethe höchstpersönlich erzählt! Richtig. Goethe. Der berühmte und mittlerweile schon über 70 seiende Schriftstelle verliebt sich in eine 19-jährige. Unmöglich? Er weiß. Leidenschaftlich, aufregend und zart erzählt aber auf jeden Fall.<br />"Ein liebender Mann" gilt als Martin Walser populärster Roman. Warum, sollte jeder selbst für sich herausfinden. Ich persönlich erachte den Roman als definitiv lesenswert. Wer sich in seiner Frezeit nicht überwinden kann, sich Goethes Leben zu widmen, erfährt im Buch wenigstens einen aufregenden Teil seines Lebens. An den Erzählstil muss man sich erst gewöhnen. Hypotaxen scheinen seine liebsten sprachlichen Mittel zu sein. Entweder man mag es, oder man mag es nicht. Ich für meinen Teil mag es.
Weniger
Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 5 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Broschiertes Buch
So weit so gut, hätte Ulrike da wohl gesagt, s.w.s.g.
Walsers männlicher Protagonist, der 74-jährige Johann Wolfgang von Goethe, erschießt sich bekanntlich nicht, wie es seine berühmte Romanfigur, der junge Werther, aus Liebesgram getan hat, womit damals ja eine …
Mehr
So weit so gut, hätte Ulrike da wohl gesagt, s.w.s.g.
Walsers männlicher Protagonist, der 74-jährige Johann Wolfgang von Goethe, erschießt sich bekanntlich nicht, wie es seine berühmte Romanfigur, der junge Werther, aus Liebesgram getan hat, womit damals ja eine Aufsehen erregende Welle von Nachahmungstaten ausgelöst wurde. Gleichwohl leidet auch der greise Geheimrat im Sommer 1823 unsäglich an Liebeskummer, zum Ausdruck gebracht in der Marienbader Elegie, diesem Liebesgedicht aus «Glut, Blut, Mut und Wut». Martin Walser nutzt für den Stoff seines biografischen Liebesromans eine Informationslücke im ansonsten bestens dokumentierten Leben des großen Dichters, seine beim Kuraufenthalt in Marienbad aufgeflammte späte Liebe zu der 55 Jahre jüngeren Ulrike von Revetzlow. Altersunterschiede dieser Größenordnung waren und sind immer ein beliebtes Thema, denn nicht nur Charlie Chaplin ist ja im Opa-Alter noch Vater geworden, auch die Liste der Lustgreise unserer Tage ist ellenlang, in den bunten Blättern der Boulevardpresse stets süffisant kommentiert, die prominenten Namen setze ich mal als bekannt voraus. Im frühen Neunzehnten Jahrhundert hingegen ging es weitaus betulicher zu, wie wir bei Walser nachlesen können.
Der Roman ist dreiteilig aufgebaut und beginnt furios mit der Schilderung der Liaison, die sich da anbahnt, allerdings nur in der Wunschvorstellung des alten Herrn. Das ungleiche Paar versteht sich jedenfalls blendend und sprüht vor Lebensfreude, Walser erzählt das beinahe wie eine Komödie, mit Witz und Elan jedenfalls. Es gibt amüsante Dialoge zwischen den Beiden, überhaupt wird die Konversation zu jener Zeit und in diesen Kreisen als recht geistreich dargestellt, mit verschiedensten anspruchsvollen Themen befasst. Man gibt sich auch ganz genüsslich dem bei solchem Kuraufenthalte üblichen Reigen wiederkehrender Zerstreuungen hin, lange Spaziergänge auf der Promenade, gegenseitige Besuche, kleine Landausflüge, Dinner-Einladungen und pompöse Bälle. Und unser Lustgreis, der Geheimrat Goethe, geht dann doch tatsächlich so weit, seinen ebenfalls kurenden Landesherren zu bitten, für ihn bei der verwitweten Mutter um die Hand der nichtsahnenden 19-jährigen Ulrike anzuhalten. Und das läuft, man ahnt es gleich, gründlich schief!
Es folgt die übereilte Abreise der angehimmelten Jungfrau, von der wir so gut wie nichts erfahren, die der Autor jedenfalls wie einen unbedeutenden Kometen an der strahlenden Sonne namens Goethe vorbeifliegen lässt. Sicher ist nur ihr weiblicher Status, die Jungfräulichkeit also, denn über ein überschwängliches, völlig unschuldiges Küsschen auf die geschlossenen Lippen ist es nicht hinaus gegangen zwischen den Beiden, wie Walser uns erzählt. Wobei er sich, ohne Not allerdings, denn das alles ist ja nur Fiktion, streng an die Tatsachen hält, Ulrike von Levetzow hat sich dazu später nämlich sehr eindeutig erklärt. Der Autor beginnt nun zu schwadronieren im zweiten Teil seines Romans, Goethes Liebeskummer, diese seitenlange Rührseligkeit, oft in inneren Monologen oder fiktiven Briefen ausgedrückt, ist schwer zu ertragen. Man fühlt sich als Leser nach der erfrischenden Oase des ersten Teils plötzlich in einer öden Wüste und kämpft sich durch, begegnet Seite um Seite einer unsäglichen Larmoyanz, die regelrecht peinlich ist und langweilig obendrein.
Im dritten Teil greift Walser auf die Technik des Briefromans zurück und schildert so die langsam einsetzende Erkenntnis seines Protagonisten, dass er diese ja nur imaginierte Liebschaft aus seinen Gedanken streichen muss. Aber das gelingt nicht, lässt der Autor uns wissen, denn in Walsers vulgärer Pointe ganz am Ende des Romans wacht der Herr Geheimrat morgens auf und hält seinen Morgensteifen in den Händen, wir wissen also genau, wovon der 74-Jährige geträumt hat. So weit so gut, hätte Ulrike da wohl gesagt, s.w.s.g.
Weniger
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für