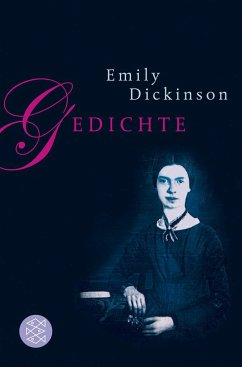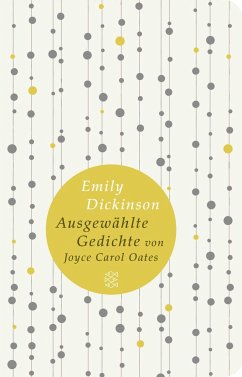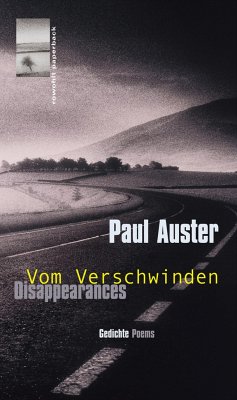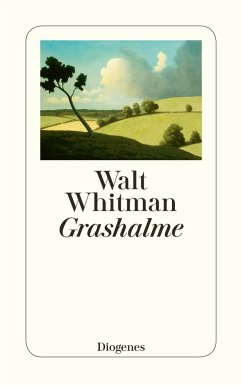Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Als der Arzt Raymond Carver mitteilte, er hätte nur noch wenige Monate, wusste er, es blieb nur noch Zeit für Gedichte. In ihnen findet sich alles aus seinen Stories wieder: die unerwarteten Wendungen, die Lakonie. Der Leser ist gebannt von der Aufmerksamkeit und Gelassenheit, mit der Carver den Lauf der Welt betrachtet.
Raymond Carver, geb. 1938 in Clatskanie, Oregon, schlug sich jahrelang mit Gelegenheitsjobs durch und konnte sich erst spät ganz dem Schreiben widmen. Sein erster Erzählungsband ¿Würdest Du bitte endlich still sein, bitte¿ machte ihn 1976 schlagartig berühmt, ¿Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden¿ brachte den endgültigen Durchbruch. Heute gilt Carver als Neubegründer der modernen amerikanischen Short Story. Er starb 1988, kurz vor seiner Aufnahme in die American Academy of Arts and Letters. Zuletzt erschien aus seinem Nachlass ¿Beginners - Uncut¿, die unlektorierte Fassung von ¿Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden¿. Helmut Frielinghaus, geb. 1931 in Braunschweig, arbeitete von 1952 - 1957 in der Libería Buchholz in Madrid und fing an, aus dem Spanischen zu übersetzen. In Deutschland arbeitete er anschließend als Lektor und Verlagsleiter bei Rowohlt, Claassen und Luchterhand. Zuletzt übertrug er neben Raymond Carver Nicholson Baker, gemeinsam mit Sabine Höbel, John Updike und William Faulkner. 2011 wurde er mit dem Paul-Scheerbart-Preis der Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Stiftung ausgezeichnet. Er starb im Januar 2012. Die deutsche Übertragung der Gedichte Carvers ist seine letzte Arbeit.
Produktdetails
- Fischer Taschenbücher 95005
- Verlag: FISCHER Taschenbuch
- Originaltitel: A New Path to the Waterfall
- Artikelnr. des Verlages: 1015597
- 1. Auflage
- Seitenzahl: 148
- Erscheinungstermin: 25. April 2013
- Deutsch
- Abmessung: 221mm x 146mm x 20mm
- Gewicht: 316g
- ISBN-13: 9783596950058
- ISBN-10: 3596950058
- Artikelnr.: 36798682
Herstellerkennzeichnung
FISCHER Taschenbuch
Hedderichstr. 114
60596 Frankfurt
produktsicherheit@fischerverlage.de
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Staunend über Carvers Verskunst lässt dieser Band Nico Bleutge zurück. Den nahen Tod des Autors spürt er zwar zwischen den Zeilen, doch von Wehleid keine Spur. Dafür von Liebe, sinnlich, dunkel und schwer, mit bisweilen melancholischen Bildern, etwa: "Die Zeit ist ein Silberlöwe". Intensiv findet Bleutge die Stücke, erzählerisch dem Unsäglichen nachspürend, dem Jenseits, der Abendluft, der Liebsten im Schlaf. Wenn Carver Gedichte von Milosz und Tanströmer unter die eigenen mischt, empfindet der Rezensent das als folgerichtig, wie Echos oder Kommentare zu Carvers Texten. Dass die Originaltexte im Band fehlen, kann Bleutge nur verschmerzen, da die Übertragungen von Helmut Frielinghaus ihm so kongenial erscheinen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
auch ohne die Originale wird klar, wie gut Helmut Frielinghaus Carvers flapsigen Ton ins Deutsche geholt hat Nico Bleutge Stuttgarter Zeitung 20130920
Für dieses Produkt wurde noch keine Bewertung abgegeben. Wir würden uns sehr freuen, wenn du die erste Bewertung schreibst!
Eine Bewertung schreiben
Eine Bewertung schreiben
Andere Kunden interessierten sich für