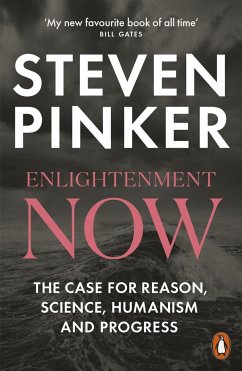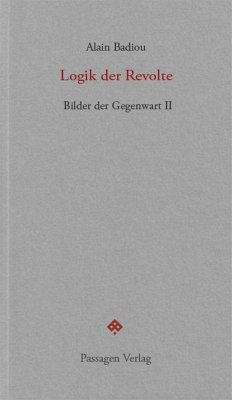Nicht lieferbar
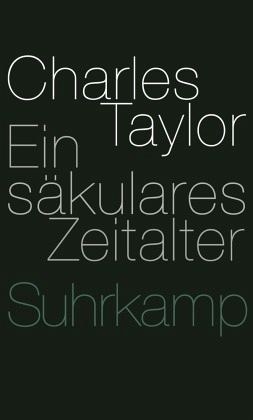
Ein säkulares Zeitalter
Ausgezeichnet mit dem Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch
Übersetzung: Schulte, Joachim
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Was heißt es, daß wir heute in einem säkularen Zeitalter leben? Was ist geschehen zwischen 1500 - als Gott noch seinen festen Platz im naturwissenschaftlichen Kosmos, im gesellschaftlichen Gefüge und im Alltag der Menschen hatte - und heute, da der Glaube an Gott, jedenfalls in der westlichen Welt, nur noch eine Option unter vielen ist?Um diesen Wandel zu bestimmen und in seinen Folgen für die gegenwärtige Gesellschaft auszuloten, muß die große Geschichte der Säkularisierung in der nordatlantischen Welt von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart erzählt werden - ein herkulisches Un...
Was heißt es, daß wir heute in einem säkularen Zeitalter leben? Was ist geschehen zwischen 1500 - als Gott noch seinen festen Platz im naturwissenschaftlichen Kosmos, im gesellschaftlichen Gefüge und im Alltag der Menschen hatte - und heute, da der Glaube an Gott, jedenfalls in der westlichen Welt, nur noch eine Option unter vielen ist?Um diesen Wandel zu bestimmen und in seinen Folgen für die gegenwärtige Gesellschaft auszuloten, muß die große Geschichte der Säkularisierung in der nordatlantischen Welt von der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart erzählt werden - ein herkulisches Unterfangen, dem sich der kanadische Philosoph Charles Taylor in seinem mit Spannung erwarteten neuen Buch stellt. Mit einem Fokus auf dem »lateinischen Christentum«, dem vorherrschenden Glauben in Europa, rekonstruiert er in geradezu verschwenderischem Detail die entscheidenden Entwicklungslinien in den Naturwissenschaften, der Philosophie, der Staats- und Rechtstheorie und in den Künsten. Dem berühmtenDiktum von der wissenschaftlich-technischen »Entzauberung der Welt« und anderen eingeschliffenen Säkularisierungstheorien setzt er die These entgegen, daß es die Religion selbst war, die das Säkulare hervorgebracht hat, und entfaltet eine komplexe Mentalitätsgeschichte des modernen Subjekts, das heute im Niemandsland zwischen Glauben und Atheismus gefangen ist.