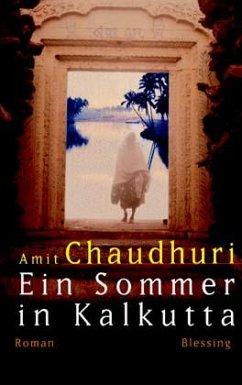Auch in diesem Jahr ist es wieder soweit: Jayojit Chatterjee, genannt Joy, Dozent für Wirtschaftswissenschaften an einer Universität im amerikanischen Mittelwesten, besucht für einige Wochen seine Eltern in Indien, zusammen mit seinem siebenjährigen Sohn Bonny. Doch dieser Sommer im schwülheißen Kalkutta ist mehr als nur ein Höflichkeitsbesuch. Joy hat ein schweres Jahr hinter sich: Seine Ehe mit der Bengalin Amala ist gescheitert und mittlerweile auch geschieden; bis auf ein paar Wochen im Jahr lebt Bonny bei ihr in San Diego. Joys Vater, ein Admiral außer Dienst, der sich gerade von einem Schlaganfall erholt, und seine Mutter, eine zurückhaltende, stille Frau, kennen weder die genauen Hintergründe der Scheidung ihres Sohnes noch haben sie eine Vorstellung davon, wie sich sein Leben im fernen Amerika gestaltet. Sie machen sich Sorgen um Joy, und doch ist der Besuch von Sohn und Enkel ein großes Ereignis, auf das sie sich monatelang gefreut haben... EIN SOMMER IN KALKUTTA erzä hlt von Menschen, die sich scheinbar in einer Art emotionalem und seelischem Stillstand befinden - einem Schwebezustand, der es ihnen ermöglicht, wieder ein Stück weit zu sich selbst zu kommen (wie Joy) oder auch einfach nur die begrenzte Zeit zu genießen, die sie miteinander haben. Ob wir Bonny und seinem Vater bei einem Pingpongspiel zusehen, sie auf einem Ausflug zum Markt begleiten oder mit Joy einen Sari für seine Mutter kaufen: Immer vermittelt sich gerade in den winzigsten Details eine Vielfalt von zwischenmenschlichen Stimmungen, die Chaudhuri mit seismographischer Feinheit aufzeichnet und in Bilder von großer poetischer Kraft fasst.

Amit Chaudhuri rückt den west-östlichen Diwan in die Wartelounge
Die Ferne im Osten hat eine feste Beziehung in unseren geistigen Wahlverwandtschaften, vom west-östlichen Diwan, dem Exotismus des neunzehnten Jahrhunderts, Poona, dem Wallfahrtsort westlicher Zivilisationsflüchtlinge bis hin zum Indipopsong "Mundian Tho Bac Ke", der es vor kurzem noch auf Platz zwei der deutschen Hitparade brachte. Außerdem: haben entwickelte Kulturen nicht inzwischen so viel Fremdes in sich aufgenommen, daß es bereits zu ihrer Normalität gehört? Doch der Blick in diesen naheliegenden Spiegel vermittelt eher soziale Probleme als schöne Bildung und verursacht zwischen Fremd- und Eigenbildern leicht Sehstörungen.
Dem kulturwissenschaftlich auf den Grund zu gehen haben sich namentlich postkoloniale Studien vorgenommen. Auch dabei spielt Indien eine - neue - Rolle fürs Abendland. Dies gilt allerdings, und das ist nicht minder neu, auch umgekehrt: Indische Literatur bereitet dem Westen einen eigenen ost-westlichen Diwan. Welche Vorstellungen darauf Platz finden, illustriert der Roman "Ein Sommer in Kalkutta" von Amit Chaudhuri (geboren 1964).
Der Titel scheint allerdings auf den Text hereinzufallen. Er trifft zwar die Sache, vergibt aber gerade das Thema. Im englischen Original heißt er: "A New World". Der Autor mußte wissen, worauf er sich damit einließ: Er hat in Oxford Literatur studiert. Utopisches Erzählen von Francis Bacons "Neuem Atlantis" zu Aldous Huxleys "Schöner neuer Welt" bis zu George Orwell (in Indien geboren) dürfte das Problem sein, auf das er seinen Roman projiziert. Wenn überhaupt, so könnte dieser erst dadurch interessant werden. Denn die Geschichte selbst scheint alle Ansprüche des englischen Titels zu leugnen.
So gut wie nichts geschieht. Joy, Wirtschaftswissenschaftler an einer amerikanischen Universität im mittleren Westen, verbringt mit seinem siebenjährigen Sohn Bonny die Sommerferien bei seinen Eltern in Kalkutta. Zahlreiche Nahaufnahmen führen ein Leben im Kleinformat vor: halbe Gespräche, schnell unterbrochen, wiederaufgenommen; Fragen nach Befindlichkeiten, aber nur flüchtig ausgetauscht; keine Diskussionen, als ob die lähmende Schwüle Kalkuttas über alles einen Schleier der Unerheblichkeit gebreitet hätte; Austausch von Höflichkeiten auf dem Flur des Wohnblocks; Begegnungen am Aufzug; kleine Spaziergänge im Schatten; Blicke auf Kolonialvillen; gelegentlich eine Taxifahrt; Warten beim Geldumtausch; ein Tischtennisspiel mit dem Sohn; Notizen über häusliche Versorgung, vor allem über bengalische Küche. Ein weithin ruhender Text, in die Breite erzählt, der Boden mit undramatischen Alltäglichkeiten bedeckt, im übrigen nur mäßig lokal koloriert. Einzig eine Fülle von Ausdrücken in der Landessprache sorgt für - eher beschwerliche - Exotik.
Dieses Kammerspiel eines Familienbesuchs wirkt vor allem durch seine Enthaltsamkeit. Kein hartes Wort, keine schroffe Geste wird zugelassen. Im gleichmäßig hinfließenden Text scheint der Orient Stil geworden zu sein. Darin liegt, für westliche Augen, sein Risiko: daß man das Geduldige und Verhaltene wie beim vorigen Roman Chaudhuris, "Melodie der Freiheit" (2001), geschehen, meditativ, esoterisch verrechnet oder ihm vage jene "unterirdisch zeitlose Welt der Werte und des Geistes" zugute hält, womit Hesses "Siddhartha" bis heute fasziniert.
Chaudhuri aber hatte wohl ganz anderes im Sinn. Es sollte zu denken geben, daß er in England und Indien bereits in einem Atemzug mit R. K. Narayan ("Der Fremdenführer", 1986) oder A. Desai ("Spiele in der Dämmerung", 2001) genannt wird. Wer allerdings mehr von seiner Geschichte haben will, muß auf die kleinen Strudel eingehen, die da und dort die Textoberfläche kräuseln. Nur sie deuten auf Steine des Anstoßes in der Tiefe, die nach und nach eine Art Lebensachse hinter der Geschichte zutage fördern. Sie dreht sich um die Bindung des Sohns an die Eltern, die unter dem Spannungsbogen von Amerika und Indien steht. In Reflexen einer doppelten Biographie kehrt die erzählende Kamera fast unmerklich immer wieder an dieselben Stellen wie an zwei wunde Punkte zurück. Der eine ist die - gescheiterte - Ehe des Sohns; der andere die Ethik. Beides hängt zusammen.
Joy hat, durchaus im Sinne der Eltern, in den Vereinigten Staaten eine Bengalin geheiratet. Nach der Geburt eines Sohnes jedoch verläßt die Frau den Vater des Kindes und liiert sich mit dem Gynäkologen, der es zur Welt brachte. Der Junge, Zeugnis ihrer Vereinigung, wird so zum Inbegriff ihrer Trennung. Joy leidet darunter, ohne es wirklich zu begreifen. Sein Besuch in Kalkutta dient der Ursachenforschung. Unmerklich vergleicht er seine mit der Ehe der Eltern und stößt zu Hause, wo er Orientierung erwartet, auf eine grundlegende Desorientierung. Für jemand, der in Amerika lebt, besitzt er (noch) zuviel bengalischen Familiensinn; für einen Bengalen ist er bereits zu amerikanisch. Sein Weg von Ost nach West läßt ihn zwischen die kulturellen Fronten geraten. In den Vereinigten Staaten war er Immigrant, in Indien Emigrant: ein Wanderer zwischen den Welten. Diese Unentschiedenheit trägt er im Blick und bekennt dadurch sein bewegendes Moment: daß Multikulturalität für die Ankömmlinge vor allem auch ein Problem der Interkulturalität ist.
Vor diesem Hintergrund kann der banale Kauf einer Waschmaschine eine Alltagsepiphanie auslösen. Sie den Eltern zu schenken hieße, die ganze Sozialordnung zu gefährden. Keine Dienstmädchen kämen mehr; andere würden Rückschlüsse auf Vermögens- und Standesverhältnisse ziehen; Hierarchien gerieten ins Wanken. Der Kauf unterbleibt. Solche Bagatellfälle lassen das Gefühl wachsen, daß der "Spiegel der Überzeugungen", in den der Sohn geschaut hat, im Begriff ist, blind zu werden. Joy findet sich in einer Grauzone von Klischees, die sich gegenseitig relativieren. Seine Scheidung zeigt seine kulturelle Unentschiedenheit an. Seine Frau hingegen hat sich, brutal ausgedrückt, für die helle Haut des Gynäkologen entschieden und damit für die Wunschwelt, die eine Bengalin daran ablesen mag.
Dementsprechend nimmt Chaudhuris Geschichte dann auch ein Ende, das keines ist. Vater und Sohn kehren nach Amerika zurück. Sie entscheiden sich für die neuen Annehmlichkeiten der Zivilisation und gegen die alten kulturellen Bindungen. Und darum geht es Chaudhuri in zweiter oder dritter Hinsicht. Man beginnt zu ahnen, warum der ,Held' aufbricht, ohne wirklich anzukommen: Er ist in die Mühlen der Globalisierung geraten. Daß sein Leben wie suspendiert wirkt, kann an seiner Sozialtechnik nicht liegen: Er beherrscht beide Seiten. Jetzt aber, auf dieser Reise, geht ihm auf, was ihm fehlt: ein Drittes, in dem Indien und Amerika sich wirklich treffen können. Bisher war sein Leitstern der freie Markt als dem Mythos der Globalisierung. Gab er nicht selbst ein schönes Beispiel dafür, daß sich in dessen Namen berufliche Schranken, gesellschaftliche Grenzen, Hürden der Hautfarbe überwinden lassen? Daß Cornflakes, Ponds Talkumpuder oder eine American-Express-Karte eine Art Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit des Konsumenten stiften?
Die Scheidung ist für ihn wie eine Vertreibung aus diesem Paradies. Der Glaube an Prosperität mag vielleicht Volkswirtschaften, nicht aber Leib und Seele zusammenzuhalten. Joy beschleicht eine marktwirtschaftliche Glaubenskrise. Nichts könnte diese ideologische Deckungslücke besser zeigen als ein ebenfalls beiläufig hingeworfenes Zeichen. Seit längerem schon will er ein Buch über Wirtschaftsethik schreiben. Die Reise nach Indien sollte ihn dazu inspirieren, aber statt dessen hat sie ihn nur noch weiter davon abgebracht. Globalisierung, so der wachsende Verdacht, ist keine Heilsmaschine, sie hat keine Moral. Sie lädt allenfalls zu zivilisatorischen Arrangements ein. Wer mehr von ihr erwartet als Joy, könnte sich am Ende als kulturell Obdachloser wiederfinden. In der Mitte dieser Geschichte tut sich eine empfindliche weltanschauliche Leerstelle auf.
Und Europa? Liegt es nicht - in der Mitte - zwischen Indien und Amerika? Haben nicht Romanfigur und Autor dort studiert? Europa ist die große Abwesende in diesem Zusammenhang. Die Wanderbewegung des Protagonisten folgt zwar den Spuren des europäischen Kolonialismus nach England. Doch der Weltgeist der Globalisierung, der ihn beerbt, hat Europa längst westwärts verlassen. Zurück bleibt, aus Sicht des Orients, ein kulturelles Museum auf einem ,alten' Kontinent (was ihm die Neue Welt inzwischen ganz offen bestätigt). Irgendwie, so scheint es, korrespondiert die dezentrale Existenz, die Chaudhuris Held führt, mit diesem Europa, das keine Mitte mehr ist.
Wenn Joy deshalb mit seinem Sohn wieder nach Amerika aufbricht, dann ohne Überzeugung, eher wie ein Kulturwaise. Kaum etwas könnte seine Minderung besser vor Augen führen als das Schlußbild dieses Romans. Was früher ein west-östlicher Diwan war, ist dort einer Wartelounge auf dem Flughafen gewichen. Kein geistiger Austausch, höchstens flüchtige Begegnungen an einem unverbindlichen Durchgang, eine davon mit einer Amerikanerin, die sich im Flugzeug fortsetzt. "Er fühlte sich nicht im geringsten von ihr angezogen und registrierte beruhigt, daß es ihr mit ihm vermutlich genauso ging."
Chaudhuris Roman "Ein Sommer in Kalkutta" ist ein verhaltenes, fast verschwiegenes Buch, die auf den zweiten Blick eine sehr aktuelle Geschichte, auch in europäischer Sicht erzählt. Diese allerdings ist nichts für eilige Leser: Sie würden wenig davon haben.
WINFRIED WEHLE
Amit Chaudhuri: "Ein Sommer in Kalkutta". Roman. Aus dem Englischen übersetzt von Gisela Stege. Karl Blessing Verlag, München 2002. 223 S., geb. 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Winfried Wehle ist den Strudeln auf der ruhigen Erzähloberfläche von Chaudhuris Roman nachgegangen und dort vom abwesenden Europa heimgesucht worden. Auf den ersten Blick sei es ein "verhaltenes, fast verschwiegenes Buch", das "Kammerspiel eines Familienbesuchs", den der in den USA lebende Wirtschaftswissenschaftler Joy seinen Eltern in Kalkutta abstatte. Es passiert eigentlich nichts, konstatiert Wehle, der an die "geistigen Wahlverwandtschaften" des orientalistisch gebildeten Europas erinnert wurde und prompt "Leben im Kleinformat" und "beschwerliche Exotik" findet. "Im gleichmäßig hinfließenden Text", schreibt er, "scheint der Orient Stil geworden zu sein." Das sei der Roman, zu dem der Titel "Ein Sommer in Kalkutta" gehört. Doch aufgepasst! - macht Wehle die Leser aufmerksam: Es gibt noch einen versteckten zweiten, der den Originaltitel "A New World" trägt und von der fundamentalen Desorientierung Joys zwischen Amerika und Indien handelt. Hier wie dort beherrsche Joy die sozialen Regeln, aber er suche "ein Drittes, in dem Indien und Amerika sich wirklich treffen können". War ihm das bis dahin die globalisierte Welt des freien Marktes, so ist er nun in eine "marktwirtschaftliche Glaubenskrise" geraten - Symptom einer "empfindliche weltanschauliche Leerstelle". Und genau an der Stelle steigt für Wehle Europa am Horizont auf, "vom Weltgeist der Globalisierung verlassen" und längst "keine Mitte mehr" - als heimliches Spiegelbild des zerrissenen Protagonisten.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH