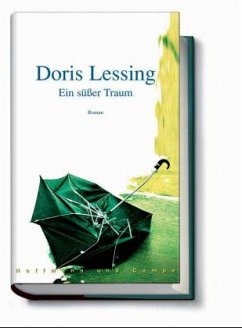Ausgeträumt - der Traum von der idealen Gesellschaft? Doris Lessing blickt in ihrem Roman, der zum großen Teil in den sechziger Jahren spielt, bilanzierend zurück. "Die gnadenloseste Sezierung von männlichem Egoismus seit dem 'Goldenen Notizbuch'." Times Literary Supplement
Während der fanatische Kommunist und brillante Agitator Johnny sich den "großen und wichtigen" Dingen des Lebens widmet - neben der Politik ständig wechselnden Liebesverhältnissen -, überlässt er seiner Mutter sowie seiner Ex-Frau Frances die Verantwortung für die beiden Söhne. Und Frances kümmert sich im London der sechziger Jahre nicht nur um den eigenen Nachwuchs. Eine ganze Schar von Jugendlichen findet in ihrem Haus Zuflucht und versammelt sich regelmäßig um den großen Küchentisch. Dieser Tisch ist das Herzstück der bunt zusammengewürfelten Gemeinschaft: Hier wird gegessen, gelacht, über private Probleme und immer wieder über Tagespolitik, Ideologien und gesellschaftliche Utopien gesprochen. Während dieser Zusammenkünfte kommen sich drei Frauengenerationen immer näher: die aufopferungsvolle Frances, ihre Schwiegermutter Julia und die junge Sylvia, die Jahre später als Missionsärztin nach Afrika aufbricht.
Doris Lessings Roman liest sich wie eine Autobiografie. Sie setzt sich kritisch mit dem politischen Umbruch der sechziger Jahre auseinander und rechnet schonungslos mit dem Kommunismus ab, den sie in Europa wie in Afrika für gescheitert erklärt.
Während der fanatische Kommunist und brillante Agitator Johnny sich den "großen und wichtigen" Dingen des Lebens widmet - neben der Politik ständig wechselnden Liebesverhältnissen -, überlässt er seiner Mutter sowie seiner Ex-Frau Frances die Verantwortung für die beiden Söhne. Und Frances kümmert sich im London der sechziger Jahre nicht nur um den eigenen Nachwuchs. Eine ganze Schar von Jugendlichen findet in ihrem Haus Zuflucht und versammelt sich regelmäßig um den großen Küchentisch. Dieser Tisch ist das Herzstück der bunt zusammengewürfelten Gemeinschaft: Hier wird gegessen, gelacht, über private Probleme und immer wieder über Tagespolitik, Ideologien und gesellschaftliche Utopien gesprochen. Während dieser Zusammenkünfte kommen sich drei Frauengenerationen immer näher: die aufopferungsvolle Frances, ihre Schwiegermutter Julia und die junge Sylvia, die Jahre später als Missionsärztin nach Afrika aufbricht.
Doris Lessings Roman liest sich wie eine Autobiografie. Sie setzt sich kritisch mit dem politischen Umbruch der sechziger Jahre auseinander und rechnet schonungslos mit dem Kommunismus ab, den sie in Europa wie in Afrika für gescheitert erklärt.

Wie sollen wir leben? In ihrem Roman "Ein süßer Traum" stellt Doris Lessing Selbstsucht und Humanität gegenüber und langweilt mit einer Flut von Stereotypen.
Doris Lessings jüngster Roman "Ein süßer Traum" ist das genaue Gegenteil des Titels, nämlich bittere Prosa. Sie rechnet in einem Buch, das in zwei Teile zerfällt, zuerst mit den antiautoritären Sechzigern in England ab, um sich dann dem Elend der Korruption in einem afrikanischen Staat namens Simila zuzuwenden, dessen neue republikanische Elite die kommunistischen Ideale der Londoner Intelligenzija in denkbar bigotter Weise an den Mann bringt.
Die ehrgeizige Konstruktion verklammert drei Generationen durch ein Haus in Nordlondon. Es gehört Julia Lennox, einer gebürtigen Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihrer Jugendliebe auf die Insel folgte und nach dem Tod ihres Mannes ein wilhelminischer Fremdkörper inmitten der lockeren Sitten der Jugend ist. Ihr einziger Sohn Johnny nennt sie aufreizend "Mutti", um pikierte Distanz zu ihren Wurzeln zu demonstrieren. Er macht Karriere als moskauhöriger Demagoge und lässt seine Frau Frances mit zwei Söhnen sitzen. "Du bist eine richtige Arbeiterfrau", lobt er die zwischen Töpfen und Wäscheleinen Hausende bei einer Stippvisite, um postwendend zu verkünden, dass er sich in eine "echte Genossin verliebt" habe. Doch als Julia die Schwiegertochter in ihr Haus holt, steht er nicht an, sich jahrelang von Frances bekochen zu lassen, seine psychisch angeknackste Zweitfrau nebst Tochter bei ihr unterzubringen und Parteifreunde zum Schlafen zu deponieren.
So stereotyp Lessing diesen Tunichtgut zeichnet, so unwahrscheinlich ist die Duldsamkeit, die Frances an den Tag legt. Täglich werden neue Sozialfälle unter ihren Fittichen verstaut, selbstgerechte Schwätzer im Namen der siegreichen Sache mit Kost und Logis versorgt. Mit ihren reaktionären Eltern hadernde Teenager fühlen sich besonders wohl in Julias großem Haus, doch auch Frances' zweiter Mann bringt zwei schwierige Kinder und seine Exfrau als Einstand mit. Man muss es wohl als Parabel unerschütterlicher weiblicher Ressourcen lesen, dass Frances trotz ihres Großküchenschicksals Karrieren als Schauspielerin, Journalistin und Autorin hinlegt. "Frances hatte den ganzen Tag versucht, mit dem gewichtigen soziologischen Buch voranzukommen, das sie schrieb, unterbrochen durch Anrufe von der Schule, von Meriels Krankenhaus und von Rupert aus der Redaktion ..."
Johnny erscheint regelmäßig, wenn der Tisch gedeckt ist, um die versammelte Jüngerschaft mit Vorträgen über Nicaragua und die Machenschaften des CIA zu unterhalten. Wie alle anderen Nutznießer den beiden selbstlosen Frauen ist er bombensicher imprägniert gegen die Widersprüche seiner ideologischen Märchen, die auf martialische Umverteilung hinauslaufen. Alles, was Frances nicht bereitstellt, Kleider und Bücher vor allem, wird von Johnnys Gefolgschaft geklaut: "Er nannte es ,befreien'." Lessing bietet eine seltsame Schicksalsphilosophie, um das eklatante Missverhältnis zwischen denen, die abräumen, und denen, die die Zeche bezahlen, zu erklären. Es habe seine eigenen Vorstellungen, das Schicksal, schreibt sie: "Aber vielleicht war das Schicksal nichts weiter als das eigene Temperament, das unsichtbar Menschen und Ereignisse anzieht. Es gibt Menschen", überlegt Frances, die "dem Leben gegenüber eine gewisse Passivität an den Tag legen und abwarten, was ihnen geschenkt, ihnen aufgetischt wird. Oder was sie bedrängt."
Das Interesse der Erzählerin gilt diesen sanften Charakteren, auch wenn sie nicht allzu begabt dafür ist, sie menschlich attraktiv zu gestalten. Während die Egoisten, emotionalen Sadisten und Wichtigtuer aus Johnnys Holze auch sexuell erfolgreiche Freibeuter sind, bleiben die guten Seelen peinlich verklemmt. "Sie war sogar bereit, über Zärtlichkeiten und Gespräche zur Schlafenszeit in ihrem vormals ehelichen Bett nachzudenken", heißt es von Julia und ihrem keuschen Verhältnis zum Exildeutschen Wilhelm. Und wenn Frances über ihren Neuen Rupert nachgrübelt, ist die sinnliche Seite schnell abgehakt: "Ganz abgesehen vom Sex, den sie als angenehm in Erinnerung hatte, war sie bei ihm in bester Gesellschaft."
"Ein süßer Traum" feiert Askese und Selbstverleugnung als letztes Mittel gegen den grassierenden Hedonismus, und es ist kein Zufall, dass diese Hinterwäldlerposition ebenso als deutsches Spurenelement eingeführt wird wie die "Verkorkstheit" der "in permanenter Auflösung" lebenden WG-Gestrandeten: "Das sind alles Kriegskinder, deswegen. Zwei schreckliche Kriege, und dies ist das Ergebnis." Denn die Deutschen neigen "zu Extremen", wie Wilhelm seufzt. Auch Johnnys Renitenz geht auf das Konto der Mesalliance seines Vaters. Auf Julias Frage, ob er ihretwegen Schwierigkeiten in der Schule habe, begannen seine Augen zu "flackern".
Johnnys Stieftochter Sylvia, ein magersüchtiges Mädchen, ist der Liebling der Patriarchin. Sylvia studiert Medizin und spielt die Hauptrolle im zweiten Teil, der sie als Ärztin unter grimmigen Bedingungen in Afrika porträtiert. Hier wird der Roman vollends zur Sozialreportage, abgründig allenfalls ist der Kunstgriff, Johnny im Arzthelfer Joshua mit dem ganzen Arsenal ideologischer Ressentiments wiederauferstehen zu lassen. Als die schwer erkrankte und durch Denunziation einer einst im Londoner Haus durchgefütterten Journalistin um ihre Position gebrachte Sylvia von ihren afrikanischen Freunden Abschied nimmt, verflucht sie der an Aids erkrankte Joshua. Kurz nach ihrer Rückkehr in London stirbt sie: Das Böse ist in seinen archaischen wie modernen Ausprägungen gleichermaßen mächtig.
Am Ende bleibt die Frage offen, wer den Sieg davonträgt, das Darwinsche System des Egoismus oder die Alchemie der Humanität? Der Verdacht bleibt, dass Julias und Frances' ausbeuterische Kommune, diese zusammengeschwemmte Großfamilie, das Ideal des Gemeinschaftslebens für Lessing ist. Hier schreibt eine von bürgerlicher Skepsis getränkte Seele, die danach süchtig ist, von der Not der vielen überrollt zu werden. Sie sind das Alibi dafür, eigene Probleme hintanzustellen. So entsteht ein Buch, das die Anatomie der Selbstsucht vorbildlich kartographiert, aber kaum durch eine differenzierte Figur zu fesseln vermag. Lauter Stereotypen, zum Abwinken Gute und Böse, eine in den Seilen der Ideologiekritik gefangene Erzählerin, aber kein Roman.
INGEBORG HARMS
Doris Lessing: "Ein süßer Traum". Roman.
Aus dem Englischen von Barbara Christ. Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2011. 526 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Dieses Buch vereinigt der Rezensentin Bernadette Conrad zufolge etliche Lebensthemen Doris Lessings - die Zukunft der menschlichen Gesellschaft, die politische, soziale Illusion und ihre Enttäuschung, Afrika als Spiegel der Welt und ihrer Probleme. Es stelle außerdem ihre Meisterschaft in der Darstellung dessen, woran die Welt krankt, unter Beweis. Dennoch mag Conrad den Roman nur mit Abstrichen als gelungen bezeichnen. Es geht um desillusionierte Frauen in einem fiktiven afrikanischen Staat, die unermüdlich weiter daran arbeiten, Kaputtes zu reparieren. Diese Frauen sind "neurotische Hegende", in denen Conrad ein dreifaches Alter Ego der Autorin erkannt hat: Francis, die als reife Frau schreibend und liebend zu sich findet, Julia, die an der politischen Ignoranz ihres Sohnes und seiner Generation verzweifelt, und Sylvia, die sich als Ärztin für die Armen aufopfert. So stark der Roman jedoch als lebensweltliche und politische Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Welt sei, so sehr seien ihm aber auch seine Schwächen anzumerken, wenn es um Stil und Figurenzeichnung geht: hier gerate viel "grob Gestricktes" und Halbgares in den Blick. Dennoch: Ein lohnenswertes Buch, das "überraschend bleibt bis zum Schluss", schreibt Conrad.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH