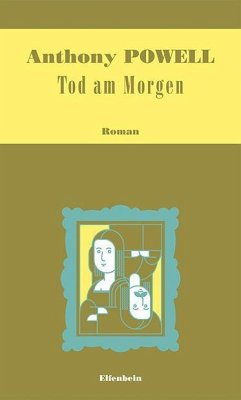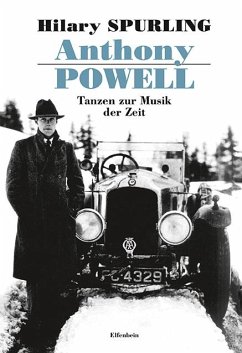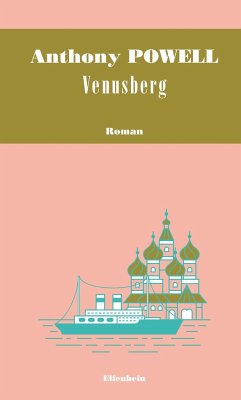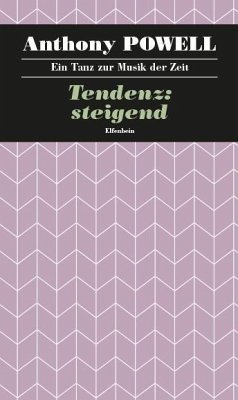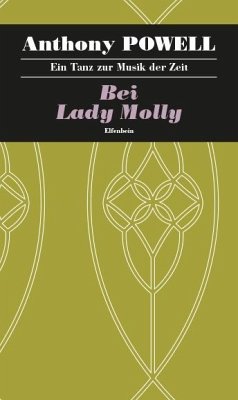Ein Tanz zur Musik der Zeit. 12 Bände
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
260,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Alle 12 Bände der deutschen Übersetzung des Romanzyklus "Ein Tanz zur Musik der Zeit" von Anthony Powell zusammen mit dem Handbuch "Einladung zum Tanz" von Hilary Spurling. Vor Oktober 2018 auch einzeln für 22 Euro je Band oder als Fortsetzung zum Subskriptionspreis von 19 Euro je Band. Vgl. Angaben bei den Einzelbänden bzw. zum Handbuch "Einladung zum Tanz".