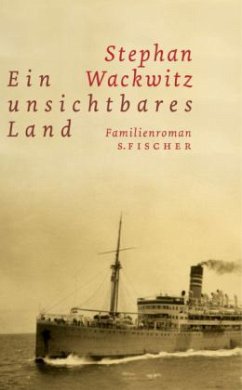"Wir leben von nicht bewusst gewordenen Erinnerungen" schreibt Ilse Aichinger.
Der Familienroman von Stephan Wackwitz ist auf der Suche nach den Erinnerungen an eine lange vergangene Zeit, von der man nichts oder doch nur wenig weiß, und die einen - manchmal befürchtet man das eher, als dass man es gerne bemerkt - viel mehr beeinflusst haben, als man glaubt. Sie haben in der Familiengeschichte und im eigenen Leben ihre Spuren hinterlassen - und was ist es für ein Glück, wenn man dieses ferne, unerschlossene Land plötzlich, für einen kurzen Moment nur, aufleuchten sieht.
Wackwitz` Vater bekommt Post von einem seltsamen Amt, das ihm die Kamera seines Vaters schickt, in der sich ein belichteter, aber noch nicht entwickelter Film befindet. Die Kamera war von den Engländern konfisziert worden, die das deutsche Schiff, auf dem der Großvater Ende der 30er Jahre nach Deutschland zurück reisen wollte, vor Afrika aufgebracht hatten. Er selbst geriet in Gefangenschaft, was ihm den Krieg erspart hat. Jahre später hat dieser Großvater einen Lebensbericht für seine Enkel geschrieben, der in Schlesien beginnt und in der Bundesrepublik endet. Die Frage für den Nachkommen ist: Was kann ein Nachkomme aus dieser Vergangenheit für das eigene Leben lernen? Was erfährt er von sich, in dieser Vor-Geschichte seiner Familie? Was sieht er auf den Fotos in der Kamera, die vielleicht die lange vergangene Zeit in sich verbirgt?
Der Familienroman von Stephan Wackwitz ist auf der Suche nach den Erinnerungen an eine lange vergangene Zeit, von der man nichts oder doch nur wenig weiß, und die einen - manchmal befürchtet man das eher, als dass man es gerne bemerkt - viel mehr beeinflusst haben, als man glaubt. Sie haben in der Familiengeschichte und im eigenen Leben ihre Spuren hinterlassen - und was ist es für ein Glück, wenn man dieses ferne, unerschlossene Land plötzlich, für einen kurzen Moment nur, aufleuchten sieht.
Wackwitz` Vater bekommt Post von einem seltsamen Amt, das ihm die Kamera seines Vaters schickt, in der sich ein belichteter, aber noch nicht entwickelter Film befindet. Die Kamera war von den Engländern konfisziert worden, die das deutsche Schiff, auf dem der Großvater Ende der 30er Jahre nach Deutschland zurück reisen wollte, vor Afrika aufgebracht hatten. Er selbst geriet in Gefangenschaft, was ihm den Krieg erspart hat. Jahre später hat dieser Großvater einen Lebensbericht für seine Enkel geschrieben, der in Schlesien beginnt und in der Bundesrepublik endet. Die Frage für den Nachkommen ist: Was kann ein Nachkomme aus dieser Vergangenheit für das eigene Leben lernen? Was erfährt er von sich, in dieser Vor-Geschichte seiner Familie? Was sieht er auf den Fotos in der Kamera, die vielleicht die lange vergangene Zeit in sich verbirgt?

Die langsame Heimkehr der deutschen Kolonialverbrechen ins historische Bewußtsein: Der Herero-Aufstand 1904/05 im Spiegel der Literatur / Von Steffen Richter
Im Mai 1922 reist der Leipziger Ingenieursstudent Kurt Mondaugen nach Warmbad, in die ehemalige deutsche Kolonie Südwestafrika. Sein Auftrag lautet, atmosphärische Funkstörungen zu untersuchen. Doch kurz nach seiner Ankunft erheben sich die Bondelzwaart-Nama und versetzen die europäischen Siedler in Angst und Schrecken. Gemeinsam mit ihnen verschanzt sich Mondaugen auf der Farm des deutschen Ex-Militärs Foppl. Während der zweieinhalb Monate andauernden "Belagerungsparty" spielt Foppl noch einmal durch, was er "1904" nennt. Die Chiffre steht für einen Krieg, den das deutsche Kaiserreich in den Jahren 1904 bis 1908 gegen die eingeborene Bevölkerung in "Deutsch-Südwest", dem heutigen Namibia, geführt hat (F.A.Z. vom 12. und 20. Januar). Sie steht für rassischen Wahnwitz, grausamste Gewalt und den Völkermord an den Herero und Nama. Mondaugens Geschichte aber wird von einem amerikanischen Autor erzählt. Als Thomas Pynchons Roman "V." 1961 erschien, lagen die Kolonialverbrechen des Kaiserreichs noch außerhalb des Horizonts der zeitgenössischen deutschen Literatur und Geschichtsschreibung.
Während man in Ostdeutschland Geschichte vornehmlich zur unumgänglichen Vorgeschichte einer befreiten sozialistischen Gegenwart erklärte, hießen die Schlagwörter in Westdeutschland "Nonkonformismus" und "Aufarbeitung der Vergangenheit". Gemeint war seit den sechziger Jahren vor allem jenes Ereignis, das bis heute den Rahmen zahlreicher deutscher Selbstbeschreibungen und kollektiver Identitätskonstruktionen absteckt: die Vernichtung der europäischen Juden im Holocaust. Der Kolonialkrieg wurde im historischen Bewußtsein schlicht überblendet. Erst in jüngster Zeit ist er wieder verstärkt in den Fokus einer breiteren Öffentlichkeit gerückt. Im September 2001 reichten Vertreter der Herero vor einem amerikanischen Gericht eine Wiedergutmachungsklage gegen die Unternehmen Deutsche Afrika-Linien und Deutsche Bank ein. Später wurde die Klage auf die Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reichs ausgedehnt. Zudem sind in den letzten Monaten mehrere wissenschaftliche und belletristische Publikationen zur Kolonialherrschaft in Deutsch-Südwestafrika erschienen. Am 12. Januar jährte sich der Ausbruch des sogenannten "Herero-Aufstands" zum hundertsten Mal.
Noch die Rede vom "Aufstand" reproduziert allerdings einen kolonialen Blick. Für die Afrikaner, die den 1885 geschlossenen "Schutzvertrag" weniger als Akt der Unterwerfung denn als "zwischenstaatliches Bündnis" interpretierten, war es Krieg. Die neuere Geschichts- und Kulturwissenschaft hat die Deutung der Auseinandersetzungen inzwischen von der europäischen Monoperspektive befreit und das Bild der vermeintlich passiven und wehrlosen Herero und Nama korrigiert. Es waren, wie Gesine Krüger nachgewiesen hat, eben keine vorgeschichtlichen Stämme, die der deutschen Kolonialmacht den Krieg erklärten, sondern durchaus militarisierte Gesellschaften mit eigenen ökonomischen, diplomatischen und Herrschaftsinteressen. Im August 1904 - der Generalleutnant Lothar von Trotha hatte das Kommando von dem als zu kompromißbereit geltenden Gouverneur Theodor Leutwein übernommen - kam es zur Schlacht am Waterberg. Den eingekesselten Herero blieb nur die Flucht ins wasserlose Sandfeld der Omaheke. Wer nicht in der Wüste umkam, wurde bei der Rückkehr von eigens aufgestellten Postenketten erschossen.
In seiner berüchtigten "Proklamation" hatte von Trotha am 2. Oktober 1904 erklärt: "Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero, mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen." Bald aber nahm man auch in Berlin wahr, daß mit dem Abschlachten sämtlicher Arbeitskräfte die koloniale Ökonomie aus den Fugen geriet. Doch in den Konzentrationslagern, in denen die Überlebenden fortan zusammengepfercht, mißhandelt und gezielt vernachlässigt wurden, setzte sich das Sterben fort. Gesicherte Zahlen der Opfer gibt es bis heute nicht. Nach einer Volkszählung von 1911 überlebten von ursprünglich etwa 80 000 Herero nur 15 130 den Kolonialkrieg, von etwa 20 000 Nama nur 9781.
Die deutsche Herrschaft in Südwestafrika war 1915 beendet. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Territorium Mandatsgebiet der Südafrikanischen Union. Die von den Deutschen etablierte "rassische Privilegiengesellschaft" (Jürgen Zimmerer) taugte jedoch trefflich zur Grundlage der später institutionalisierten Apartheid. An den Folgen der Kolonialherrschaft laboriert das seit 1990 unabhängige Namibia noch immer. Die faktisch allein regierende South West Africa Peoples Organization (Swapo) hat in den Jahrzehnten des Befreiungskampfes Strukturen entwickelt, die mit demokratischen Gepflogenheiten in Konflikt geraten. Henning Melber beschreibt den aktuellen Dekolonialisierungsprozeß als einen Übergang von "kontrolliertem Wandel hin zu gewandelter Kontrolle". Ausgrenzung von Minderheiten, polizeiliche Übergriffe und Selbstbereicherung sind an der Tagesordnung. Die aus den kolonialen Enteignungen resultierende Ungleichverteilung des Landes bleibt ein gravierendes Problem. Gleichzeitig zeichnet die offizielle Erinnerungspolitik ein selektives Geschichtsbild, das den Befreiungskampf der Swapo seit den sechziger Jahren in den Mittelpunkt rückt. Der Völkermord an den Herero und Nama kommt darin kaum vor.
In der deutschen Literatur fand der Kolonialkrieg seinen ersten Niederschlag in längst vergessenen Texten. Dabei hatte Gustav Frenssens Roman "Peter Moors Fahrt nach Südwest" von 1906 eine Gesamtauflage von mehr als einer halben Million Exemplaren erreicht. Frenssens finsterer "Feldzugsbericht", in dem "diese Schwarzen aber ganz, ganz anders sind als wir", wurde sogar Schullesestoff. Seit den zwanziger Jahren boomte das Thema vor allem in diversen Reihen populärer Groschenhefte. Hans Grimms schlagwortträchtiger Best- und Longseller "Volk ohne Raum" von 1926 kombinierte Frenssens biologistischen Rassismus mit dem Topos der Gewinnung von "Lebensraum". Denn "Blut läuft einen beharrlichen Weg", heißt es über den vermeintlichen deutschen Platzmangel, "und wo Sie es stauen, wird es gewiß krank und böse".
Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet das koloniale Engagement wenig überraschend fast vollständig aus dem Blickfeld. Erst als der Polit-Cartoonist Gerhard Seyfried im vergangenen Frühjahr in seinem Roman "Herero" den Aufstand literarisch gestaltete, erinnerten sich manche Beobachter an den 1978 erschienenen Roman "Morenga" von Uwe Timm. Vergleicht man diese beiden Werke, treten zwei grundverschiedene Modelle der ästhetischen Annäherung an den Kolonialkrieg zutage: Wo Seyfried sich mit seinem Protagonisten, dem Kartographen Carl Ettmann, dem Bewußtseinshorizont des Jahres 1904 mimetisch nähern will, wird in Timms Geschichte des Oberveterinärs Gottschalk der historische Abstand miterzählt. Während Seyfried Krieg und Völkermord in den Rahmen einer geschlossenen Fiktion spannt, arbeitet Timm mit den Mitteln der vielperspektivischen Montage. Bei Seyfried schließlich nimmt die Identität der Kolonisatoren kaum Schaden, bleibt die Grenze zwischen Eigenem und Fremdem weitgehend intakt. Bei Timm indes wird sich der Eindringling selbst fremd, fixe Demarkationslinien verwischen. Unternimmt man einige literaturgeschichtliche Stichproben, zeigen sich hier zwei Grundmodelle, die sich auch in anderen Texten wiederfinden lassen.
Gemeinsam ist fast allen der dezidiert europäische Blick auf das koloniale Geschehen. Hatte diese Perspektivwahl bei Frenssen noch die Funktion, Eigenes gegen Fremdes abzuschotten, verhindert sie heute zumeist die Anmaßung, die in der Adaption des fremden Blickes liegt. Ein Autor wie Giselher W. Hoffmann kann in "Die schweigenden Feuer" (1994) allerdings ohne weiteres eine Geschichte der Herero aus deren eigener Perspektive erzählen. Hoffmann ist als Sohn deutscher Einwanderer in Namibia aufgewachsen und verwebt in seinem Text Riten, Legenden, Sprach- und Denkgewohnheiten der Herero-Kultur. Die Weißen dringen als Fremdkörper in eine historisch gewachsene Gesellschaft ein, deren Identität durch die - freiwillige oder erzwungene - Übernahme christlich-europäischer Traditionen zunehmend in Gefahr gerät. Obwohl Hoffmanns Roman aufgrund seines oft verstörenden Vokabulars fast "fremdsprachlich" erscheinen mag, verläßt er mit seiner Konstruktion kaum den Rahmen des konventionellen historischen Erzählens.
Einen ebenso kohärenten Kosmos entwirft Dietmar Beetz' "Oberhäuptling der Herero". Der Roman erschien 1983 in einer Jugendbuchreihe des Ost-Berliner Verlags Neues Leben. Auch Beetz berichtet aus der Innensicht eines Herero, verwandelt den Kolonialkrieg jedoch in eine spannende Abenteuergeschichte mit geschichtsdidaktischem Mehrwert. Viel ist von Gemeinsamkeiten zwischen Weißen und Schwarzen die Rede. Und davon, "was wir tun, damit die Welt vielleicht einmal besser wird". Überdies erinnern die zerstrittenen Herero-Stämme an die gespaltene Arbeiterklasse zur Zeit der nationalsozialistischen Machtergreifung. Beetz' Erzählung endet sinnigerweise nicht im Desaster von 1904, sondern bereits mit einer separatistischen Erhebung der Ostherero 1896. So bleibt der Ausblick auf eine künftige Entscheidungsschlacht, in der die Herero "geschlossener, unerschrockener und schlagkräftiger als je zuvor ein Stamm" ihrem Führer Samuel Maharero folgen würden. Die Schlagworte eines (vulgarisierten) sozialistischen Realismus - Parteilichkeit, Volksverbundenheit und Gewißheit einer lichten Zukunft - finden sich aufs deutlichste vereint.
Solche abgeschlossenen Erzähluniversen eignen sich also vorzüglich zur Schilderung von Abenteuerhandlungen, die im besten Fall kulturgeschichtliche Interessen befriedigen. Nicht selten werden dabei eigene ideologische Überzeugungen in den Kampf der Afrikaner projiziert. Romane allerdings, die auf historische Einfühlung abgestellt sind und aus dem Zeitenabstand keinen Erkenntnisgewinn ziehen, gehen oftmals kolonialen Legitimationsdiskursen auf den Leim.
Mit seiner offenen Struktur, die disparates Material montiert, die Erzählperspektive munter changieren läßt und die lineare Ereignischronologie unterläuft, konnte Uwe Timms "Morenga" in ästhetischer Hinsicht lange das Maß der Dinge bleiben. Sein Protagonist entwickelt sich angesichts des Grauens auf den afrikanischen Schlachtfeldern von einem institutionsgläubigen Untertanen des Kaiserreichs zum Skeptiker, der schließlich in offene Verweigerungshaltung gegenüber seinem militärischen Kommando gerät. Gottschalk erkennt in der Sinnlichkeit und Spontaneität der fremden Kultur immer mehr Eigenes, das im Laufe des Zivilisationsprozesses zugunsten von Abstraktion und Plan verdrängt wurde. Am Ende wird er kein deutscher Soldat mehr sein, aber auch kein Nama werden können. Trotz all dieser Grenzverwischungen schlagen allerdings auch bei Timm duale Muster durch: Der mit positiven Konnotationen verbundenen Natur Afrikas steht die negativ erfahrene Zivilisation Europas entgegen.
Diese Hochschätzung des Natürlichen dürfte sich der Entstehungszeit des Romans in den siebziger Jahren verdanken, also den Debatten der Studentenbewegung. Das gilt auch für einen zweiten Aspekt: Allenthalben entdeckt Timm im Kolonialkrieg Zeichen, die auf die Ermordung der europäischen Juden vorausweisen. Den Technokraten der Berliner Kolonialverwaltung geht es lediglich um reibungslose Abläufe, emotionslos verrichten sie ihr mörderisches Geschäft. In einem Gespräch hat Timm kürzlich auf "der Linie" beharrt, "die vom deutschen Kolonialismus zur Schoa führt". Nun stehen Traditionsbezüge zwischen dem Kaiserreich und Hitlers Deutschland außer Frage. Sie sind vor allem in der Kontinuität von ideologischen Konzepten wie "Raum" und "Rasse" unübersehbar. Dennoch läßt sich aus geschichtswissenschaftlicher Sicht differenzieren, daß kein gerader Weg vom Kolonialismus zu den Nazi-Verbrechen führt. Dafür speisten sich Ideologie und Politik des Nationalsozialismus aus zu heterogenen Quellen.
Subtil und ohne eine historisch-kausale Verbindung zu behaupten, umkreisen zwei neuere Romane die Verbindung zwischen dem Völkermord in Afrika und der Vernichtung der Juden. In vielschichtigen erzählerischen Geweben verknüpfen Stephan Wackwitz' "Ein unsichtbares Land" und Christof Hamanns "Fester" die symbolischen Orte Auschwitz und Waterberg. Wackwitz stöbert in den Erinnerungskladden seines deutschnationalen Großvaters. Der war in den zwanziger Jahren Pfarrer in der Gegend von Auschwitz, in den Dreißigern südwestafrikanischer Landespropst. In dieser Zeit, erzählt er, habe er auf dem deutschen Soldatenfriedhof am Waterberg einmal eine Kobra erlegen wollen, um mit dem Kadaver einen Herero-Jungen zu erschrecken. Das Tier aber war nicht tot und verfolgte den Deutschen.
Während der Großvater die Geschichte als simples Jagdabenteuer wiedergibt, geht der Enkel ihren Subtexten nach. Das Erzählen des Großvaters, suggeriert Wackwitz in einer seiner Lesarten, kaschiert die nicht eingestandene Schuld am Hinmetzeln der Herero. Doch im Symbol der Schlange verschmilzt diese Schuld mit der an einem anderen "Bösen", das "in Wirklichkeit zu Hause auf ihn gewartet hat. Es ist ihm nicht in Afrika begegnet, sondern in seinem eigenen Land, in das er 1940 zurückgekehrt ist." Dort nämlich, wo Millionen Juden umgebracht wurden.
Hamanns Sebastian Fester hingegen stolpert als tumber Tor durch das heutige Polen, durch Namibia und die Vereinigten Staaten. Ob er sich für die Ost-Expansion einer deutschen Bäckereifirma einspannen läßt oder bei der Vermarktung touristischer "Bierreisen" in die ehemalige Kolonie hilft - immer geht es darum, die Greueltaten der Vergangenheit in einer gegenwärtigen Sicht zu kanalisieren und zu glätten, die sich grenzüberschreitend und multikulturell gibt. Festers wiederkehrende Rauschträume zersetzen nicht nur die Kohärenz des Erzählens. Sie spiegeln sehr gegenwärtige Allmachtsphantasien, die mit den genuin kolonialen Impulsen der Eroberung und Unterwerfung aufs engste verknüpft sind.
Freilich hatte schon Pynchons Kurt Mondaugen in seinen Visionen während der Belagerung von Foppls Farm das gesamte Arsenal kolonialer Grausamkeiten versammelt gesehen: Folter, Vergewaltigung, Züchtigung mit der Nilpferdpeitsche, Gefangenenselektion und Konzentrationslager. In einem Brief aus dem Jahr 1969 nennt Pynchon die Ereignisse in Deutsch-Südwestafrika eine Art "Generalprobe" für den Völkermord an den Juden. 60 000 Tote, heißt es im Roman, seien "zwar nur ein Prozent von sechs Millionen, aber immerhin auch eine schöne Leistung". Früh registriert Pynchon die unerklärliche Absenz jeglicher Emotion und beschreibt sie sarkastisch als Substitution von "Empfinden" durch "Arbeitssympathie". Nicht zuletzt in der ästhetischen Konstruktion war "V." deutschen Texten voraus. Die Afrika-Episode ist durch zwei Erzählinstanzen doppelt verschachtelt, die Erzählung selbst wird durch Delirien desintegriert und somit jeglicher mimetischer Lektüre entrückt.
Am Ende werden Mondaugens aufgezeichnete Funkstörungen als ein bekannter Wittgenstein-Satz dechiffriert: "Die Welt ist alles, was der Fall ist." Die Suche nach diskursiver Vernunft in der Geschichte scheint aussichtslos. Was bleibt, ist die Diskrepanz zwischen historischer Erkenntnisskepsis und den realen Leiden der Opfer. Doch gerade die stiften unausgesetzt zur Sinnsuche an. Literatur, das demonstriert Pynchon, ist nach wie vor ihr privilegiertes Medium.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Schön, melancholisch und gehaltvoll findet Rezensent Friedmar Apel Stephan Wackwitz' Erkundungen der Heimat, aber "in den selbstquälerischen Bekenntnissen zugleich schrecklich deutsch". Apel zufolge wird im Roman das Verhältnis des Erzählers zum Land der Väter zur Metapher für die immer wieder scheiternde "Identifikation mit dem eigenen Herkommen". Nicht zufällig sieht der Rezensent erneut ein protestantisches Pfarrhaus im Zentrum des Buches stehen, dessen Beginn ihn an Hebels Geschichte vom unverhofften Wiedersehen erinnert. Zum Anlass der die Handlung auslösenden Recherche werde der Versuch, hinter das Schweigen der Vorfahren über die Vergangenheit zu kommen. Im Laufe des Romans, dessen intellektuelle und geografische Topografien den Rezensenten sichtlich beeindruckt haben, führe das den Autor zu einer radikalen Abrechnung mit der protestantischen deutschen Tradition der Wahrheitssuche: von Fichte über Hegel zu Ulrike Meinhof und Holger Meins. Gerade diese, den Leser peinigenden Passagen dokumentieren für Apel die ganzen "Schmerzen und Verwerfungen verhinderter Identifikation" in der deutschen Nachkriegszeit. Das sei auch sehr nützlich, um die Achtundsechziger zu verstehen, versichert der Kritiker.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH