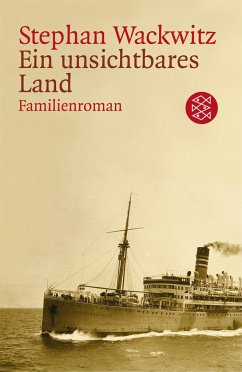Ein unverhofftes Wiedersehen und eine deutsche Geschichte: Auf verschlungenen und geisterhaft-merkwürdigen Wegen findet zu Beginn der neunziger Jahre eine altmodische Kamera ihren Besitzer wieder. Sie gehört dem fast achtzigjährigen Vater des Erzählers, der den Apparat 1939 mit siebzehn Jahren auf hoher See zwischen Angola und Argentinien einem britischen Marineoffizier aushändigen musste, bevor er in Kriegsgefangenschaft ging. Aus der Gegend von Auschwitz, dem galizischen Grenzgebiet zwischen Polen, Österreich-Ungarn und Oberschlesien war die Familie des deutschnationalen protestantischen Pastors und Veteranen des Ersten Weltkriegs Andreas Wackwitz 1933 nach Afrika ausgewandert. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verhindert die Rückkehr. Der älteste Sohn Gustav wird sieben Jahre lang in einem kanadischen Lager Bäume fällen. Seine längst vergessene Kamera wandert in ein Depot in London, später nach Berlin und reist ein halbes Jahrhundert lang durch die Zeit. Welche Bilder werden sich auf dem über sechzig Jahre alten Film finden? Stephan Wackwitz, der Enkel des Auswanderers, beginnt eine Geschichte seiner Familie zu erzählen, die unter den Händen zum Roman dreier Generationen wird.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Schiffbruch mit Zigarre: Stephan Wackwitz sucht das Land seiner Großväter und findet sich / Von Friedmar Apel
Der "Familienroman des Neurotikers" - Sigmund Freuds gattungspoetische Prägung wurde in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts zum Kanon der Revolte gegen autoritär schweigende Väter und bewußtlose Mütter politisch gewendet. Zugleich sollte damit das Ende verschleiernder literarischer Fiktion markiert werden. Glückliches Familienleben geriet unter Ideologieverdacht, über unglückliches gab es ohnehin mehr zu berichten. Kaum jedoch waren die Väter verschwunden, fielen dunkle Schatten auf die Mütterlichkeit, während ein "leidenschaftliches Begehren im Untergrund" entdeckt wurde, ein unsichtbares Phänomen namens "Vatersehnsucht". In der Literaturproduktion des letzten Jahres waren dann Mama, Papa und Kinder wieder mehr oder weniger glücklich beisammen.
Der 1952 geborene Stephan Wackwitz kommt in seiner vielschichtigen Erkundung des Landes seiner Väter wie notwendig auf den paradox erscheinenden Zusammenhang zwischen Feindseligkeit und Sehnsucht zurück. Die Geschehnisse der siebziger Jahre seien im Grunde ein "politischer Familienroman" gewesen. Der normgebende "Luckenwalder Kindheitsroman" des Rudi Dutschke sei damals "in den Formen der großen barocken Intellektuellentragödie" inszeniert worden: "Denn wenn Bloch und Lukács, Walter Benjamin, Leviné, Trotzki und Karl Liebknecht unsere Könige und Väter gewesen sind, dann waren wir damals dänische Prinzen. Ein Mord, über den niemand spricht, hat uns den König, unseren Vater geraubt."
So verknüpft sich der Rückweg des Erzählers in ein Land, "von dem wir nicht wußten, ob es eigentlich unseres war", arabesk mit der Suche nach der Heimat des Vaters und des Großvaters, der Gegend um die alte galizische Residenzstadt Auschwitz. Zehn Kilometer nördlich davon, im damals schon polnischen Anhalt, war Andreas Wackwitz von 1921 bis zu seiner Auswanderung nach Afrika 1933 Pfarrer der deutschen Gemeinde gewesen. Kurioserweise aber wurde er nach der Rückkehr aus Schiffbruch und Gefangenschaft Superintendent in Luckenwalde, wo "er für einen frommen und sportlichen Jugendlichen zuständig geworden ist, der eigentlich Alfred Willi Rudolf Dutschke hieß". Der wiederum war einmal für Stephan Wackwitz zuständig, der seit 1999 kaum eine Autostunde von jenem Land entfernt als Leiter des Goethe-Instituts Krakau die Kultur des Landes vertritt, das er nur unter Qualen zu dem seinen machen konnte.
Kurios und ähnlich unglaublich wie Johann Peter Hebels Geschichte vom unverhofften Wiedersehen ist auch der anekdotische Anlaß der Recherche. 1993 bekommt der Vater des Erzählers, Gustav Wackwitz, von der "Dienststelle für die Benachrichtigung der Angehörigen ehemaliger Soldaten der Wehrmacht" eine Kamera mit eingelegtem Film zugestellt, die ihm 1939 bei seiner Gefangennahme auf der Fahrt von Deutsch-Südwestafrika nach Bremerhaven von englischen Soldaten abgenommen worden war. Der Erzähler verrät sogleich, daß auf dem entwickelten Film nichts zu sehen war. Aber gerade diese Schwärze repräsentiert das Geheimnis der Familiengeschichte wie das der "Zukunftslosigkeit" des Erzählers in jenen siebziger Jahren und wird zum unsichtbaren Zentrum einer Herstellung von Sichtbarkeit und Perspektive, die Bilder nicht hätten leisten können. Es ist mehr als nur ein unsichtbares Land, was dabei zum Vorschein kommt. Geopolitische Topographien und kollektive und individuelle Territorien der Seele überlagern sich. Was immer der Erzähler bei seinen Recherchen findet, es verschränkt sich mit seinen eigenen Wegen.
Es beginnt mit dem Versuch, auf eine gerechtere Weise hinter das erst als beängstigend empfundene und dann verächtlich abgetane Schweigen der Vorfahren zu kommen. Der Großvater kommt mit seiner eigenen Stimme zu Wort, und zuletzt maßt sich der Enkel nicht mehr an, alles verstehen zu wollen: "Niemand dringt hier durch, und gar mit der Botschaft eines Toten." Einzelheiten dieser Botschaft aber machen sich auf "eine lächerliche, manchmal etwas bedrückende und zuweilen entschieden unheimliche" Weise in der Phantasie des Erzählers selbständig.
Was ihn topographisch umtreibt, ist jene trichterförmige Verengung der deutschen Geschichte auf die Chiffre Auschwitz, in der die Gegend seiner Väter zum "schwarzen Loch" wurde, das alle Erinnerungen in sich hineinriß und zugleich "in die Gespräche unserer Familie ein kleines, bedeutsames Schweigen" einschleppte. Das tränkt noch den heutigen Anblick, aber auch alle Erinnerungen, die Kinder lieben, "was mein Vater als kleiner Junge gemacht, gespielt und angestellt hat", mit einer kaum erträglichen Traurigkeit. Daher ist der Erzähler "bei eigentlich jedem Besuch dort froh gewesen, am Abend möglichst schnell wieder nach Krakau zurückkehren zu können". So wird das Verhältnis zum Land der Väter zur Metapher der in Deutschland immer wieder mißglückenden Identifikation mit dem eigenen Herkommen. Die neunziger Jahre, in denen "das Land zurückgefunden hat aus einem Sonderweg der Bußzerknirschung und des Sündenstolzes in die merkwürdig fließende, unabschließbare, ambivalente und personenabhängige Art von Wahrheit und Moral, die in wirklichen Demokratien gilt", beschreibt der Erzähler als Zeit der befreienden Erkenntnis, "daß man nicht nur die Geschichte, sondern auch die Wahrheit herstellen muß".
In diesem Licht erscheinen die bundesrepublikanischen Moralisten von Heinrich Böll bis Walter Jens, als ob sie "eigentlich noch vor dem Krieg gelebt hätten". So gewinnt der Erzähler den Fernblick in die Geschichte zurück und zieht ein Quentchen Glück aus der Vorstellung, daß "wir alle, seit wir Menschen sind, nicht einfach irgendwo herstammen, sondern vielmehr immer schon irgendwann irgendwo angekommen sind". Nun kann der Erzähler freier bedenken, was von seinen Vätern in ihm wirkte, als er mit dem anderen Totalitarismus liebäugelte, den Großvater in sich erkennt er noch in der äußeren Erscheinung bis hin zum vorübergehenden Spitzbauch.
Um so mehr führt ihn das zu einer radikalen Abrechnung mit der protestantischen deutschen Tradition der Wahrheitssuche in der Form der "Flammenrede", von Fichte und Hegel über Dutschke zu Ulrike Meinhof und Holger Meins. Dieses anmaßend Prophetische habe "in der deutschen Linken schon immer eine böse und zugleich ein bißchen lächerliche Hauptrolle gespielt". Das ist auch eine Abrechnung mit dem ehemaligen Spartakisten Stephan Wackwitz, mit der eigenen Feigheit und Anpassungsbereitschaft. Am Ende winkt aus dem unsichtbaren Land ein vom Vater Gustav, mit dem der Erzähler eigentümlich einig scheint, überliefertes distanzierendes Leitbild, ein auslandsdeutscher "Ritter von der komischen Gestalt", ein dicker menschenfreundlicher Exzentriker, der sich im Anblick des eigenen Schiffbruchs eine Zigarre anzündet.
"Ein unsichtbares Land" ist ein schönes, melancholisches und gehaltvolles Buch, das den Leser in die Erkundung einbezieht. Es ist aber in den selbstquälerischen Bekenntnissen zugleich schrecklich deutsch, nicht zufällig steht einmal mehr ein protestantisches Pfarrhaus im topographischen Zentrum des Romans. Gerade in diesen, den Leser peinigenden Passagen aber dokumentieren sich die ganzen Schmerzen und Verwerfungen verhinderter Identifikation in der (in der Literatur noch längst nicht abgeschlossenen) deutschen Nachkriegszeit. Wer die absurd erscheinenden Metamorphosen der Achtundsechziger im Spektrum von staatstragenden Ministern bis zu deutschnationalen oder rechtsradikalen Protagonisten verstehen will, muß dieses Buch lesen.
Stephan Wackwitz: "Ein unsichtbares Land". Familienroman. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2003. 288 S., geb., 12 Abb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main