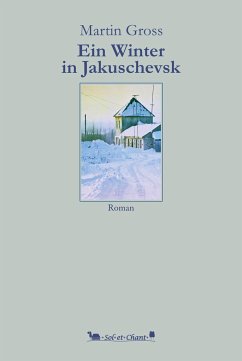Im russischen Krisenjahr 1998 erhält der Literaturwissenschaftler Martin Gross das Angebot, für eine EU-Kooperation Kontakt zu sibirischen Universitäten aufzunehmen und dort als Dozent zu arbeiten. Gross sagt zu und wird Zeuge des Systemwechsels von Jelzin auf Putin. Russland wendet sich von seiner Westorientierung ab. Martin Gross' Reise führt ihn in eine fremde Welt. Doch er begegnet den Menschen mit der gleichen beharrenden Offenheit, die bereits seinen Roman "Das letzte Jahr" zu einer herausragenden Lektüre über die letzten Monate der DDR werden ließ. Langsam und nach manchem Missverständnis gelingt es dem Autor, das Vertrauen seines Umfelds im fiktional-verdichteten Jakuschevsk zu gewinnen. Letztlich aber ist es erst die ungeklärte Liebesbeziehung zu der tatarisch-stämmigen Studentin Dilja, die ihm tiefere Einblicke in die russische Mentalität ermöglicht. Basierend auf Tagebuchaufzeichnungen ist "Ein Winter in Jakuschevsk" ein Buch der Stunde - und viel mehr. Angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine verdeutlicht es Gründe und Natur der tiefen Kluft, die weite Teile der russischen Bevölkerung vom "Westen" trennt. Gesellschaftlich erhellend, von mitfühlender Neugier getragen und stilistisch von berauschender Klarheit vermittelt das Buch Verständnis für die Menschen, die das Scheitern des Sozialismus, den Niedergang der Supermacht und eine misslungene Wirtschaftsreform verarbeiten müssen. So lesen sich manche Passagen des Romans wie ein Menetekel des aktuellen Ukraine-Krieges.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Dass Martin Gross' neues Buch als Roman verkauft wird, findet Rezensent Nils Kahlefendt etwas "kühn". Denn auch wenn der Autor und Literaturwissenschaftler die Aufzeichnungen, die er um 1998 bei einem Sibirien-Aufenthalt im Zeichen der russisch-europäischen Kooperation anfertigte, für das Buch abgewandelt und fiktionalisiert hat, begegnet der Kritiker hier nicht Spannungsbögen und Motiven, sondern einer eher "schmucklosen" Reihung, an die er sich erst gewöhnen muss. Dann jedoch streift er gerne mit Gross durch dessen fiktives, tristes Jakuschevsk mit seiner zwischen "Verzweiflung und Galgenhumor, Offenheit und Argwohn" schwankenden Bevölkerung; mit Hass auf den Kapitalismus und verletztem Nationalstolz, wie Kahlefendt Gross' Analyse wiedergibt. Und trotzdem sei das, besonders auch im Schlussteil des Buchs, in dem der Protagonist/Autor mit seiner Geliebten in den Norden Sibiriens und damit nochmal in ein ganz anderes Russland reist, ein Bericht "aus Friedenszeiten", der den Kritiker heute in einer "Mischung aus Ernüchterung und Beklemmung" zurücklässt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Zwischen Verzweiflung und Galgenhumor:
Martin Gross beschreibt in seinem Roman "Ein Winter in Jakuschevsk" das Russland kurz vor Putins Machtantritt.
Das kleine Glück abseits der Metropolen, die Datscha, ist in Russland eine Institution, ein Stück Kulturgeschichte. Literarische Klassiker wie Dostojewskis "Idiot" oder Tolstois "Anna Karenina" kommen ohne diesen symbolischen Handlungsort nicht aus; in seinem Stück "Datschniki", auf Deutsch "Sommergäste", rechnete Gorki mit der Intelligenzija ab. Für Olga, die zweiundsechzigjährige Leiterin des Instituts für Deutsche Sprache im sibirischen Jakuschevsk, ist die Datscha im russischen Krisenjahr 1998 keine Sommerfrische, sondern ein Überlebens-Ort: Von Mai an verbringt die Hochschullehrerin jedes Wochenende auf der Scholle, den Sommer über lebt sie komplett dort. Ohne das Zubrot aus den Gärten wären die Lebenshaltungskosten nicht zu bestreiten. Olga nimmt den Rückfall in halbagrarische Verhältnisse sarkastisch: "Das entspricht noch ganz dem sozialistischen Menschenbild, die allseitig entwickelte Persönlichkeit: wochentags deutsche Grammatik und am Wochenende russische Agronomie."
Die ironische, vom Leben gebeutelte Olga, die ihr Deutsch noch im sozialistischen Bruderland DDR gelernt hat, zählt im rund zwei Dutzend Köpfe umfassenden Personal von Martin Gross' "Ein Winter in Jakuschevsk" zu den konturenreichsten. In seinem neuen Buch variiert Gross einen Schreibansatz, den er bereits in seinem 1992 erschienenen Band "Das letzte Jahr" erprobt hatte: Im Januar 1990 war der im Schwarzwald geborene Autor nach Dresden gezogen, um das letzte Jahr der DDR mitzuerleben - und mitzuschreiben. In dem gefeierten Bild-Text-Band "Das Jahr 1990 freilegen" (Spector Books, 2019) gehörten Gross' längst in Vergessenheit geratene Aufzeichnungen zu den verblüffendsten Funden; Spector brachte 2020 sogar eine Neuausgabe.
Für "Ein Winter in Jakuschevsk" greift Martin Gross auf Tagebuchnotizen der Jahre von 1998 an zurück; damals erhielt der Literaturwissenschaftler das Angebot, für eine EU-Kooperation Kontakt zu sibirischen Universitäten aufzunehmen und dort als Dozent zu arbeiten. In seinem Buch anonymisiert er Personen, verlegt Szenen aus diversen sibirischen Städten ins fiktional verdichtete Jakuschevsk und verkürzt einen ursprünglich längeren Aufenthalt auf sechs Monate, die Spanne zwischen November 1998 und April 1999. Dass das Ganze nun unter der Genre-Bezeichnung "Roman" zwischen Buchdeckel kommt, ist indes einigermaßen kühn. Wer Akzentuierung, Tempowechsel, Arbeit mit Motiven oder gar Spannungsbögen erwartet, wird durch die mal datierten, mal nur mit dem aktuellen Wochentag versehenen Abschnitte der Aufzeichnungen stolpern wie ihr Autor über die von dicken Eiskrusten bedeckten Gehwege von Jakuschevsk.
Doch seltsam: Hat man sich an die etwas enervierende Art der Fortbewegung durch den spröden, schmucklosen Text gewöhnt, wird er vertrauter - wie die Stadt mit ihren eintönigen Häusern: "Alles sieht etwas trübselig aus, ergibt aber doch ein ruhiges Straßenbild. Immer die gleichen Wohnblöcke: rechteckige Form, quadratische Fenster, fünf Etagen, leicht geneigte Dächer. Aber bei sonnigem Wetter leuchten die grauen Fassaden."
Akribisch protokolliert Gross den Alltag einer desillusionierten Bevölkerung in der russischen Provinz, den freien Fall des Rubels während seines Aufenthalts und die Rufe nach einem Präsidenten, der endlich "aufräumt", inklusive. Was er sieht, ist "ein Volk zwischen Verzweiflung und Galgenhumor, Offenheit und Argwohn". Die Redewendung krysha jedet - die, frei übertragen, wohl so etwas wie "Ich dreh' hier jetzt gleich durch" bedeuten soll - könnte als Motto über allem stehen. Ausführlich wird die Situation am unterfinanzierten Institut geschildert, wo - Klassensätze sind knapp - die deutsche Gegenwartsliteratur mit Bölls "Katharina Blum", Christa Wolf und Hermann Hesse abgehandelt wird und die Kooperationsbemühungen des ahnungslosen Westlers in den Untiefen der Hochschulbürokratie versanden.
Ein Diplom gilt hier wenig: "Deutsch", so Olga, "ist eigentlich nur noch was für Mädchen und verbesserte Heiratschancen. Eine Braut mit Hochschulabschluss." Je mehr es dem Gast aus Deutschland gelingt, das Vertrauen seines Umfelds zu gewinnen, desto mehr vermag er zu sehen: Umweltverbrechen, Straßenkinder, die an den Fernwärmerohren der Kanalisation schlafen, vormalige Betriebsleiter und Genossen, die zu Managern und "Bisnesmen" mutieren. "Das ist doch eure verfluchte Marktwirtschaft", schimpft Olga angesichts eines Bauern, der vor dem Krankenhaus gefrorene Schweinestücke verkauft, um das Medikament für seinen Sohn zahlen zu können. Die Osteuropäer, sinniert der Autor auf einer der zahllosen zugigen "Straßen der Roten Armee", haben nach dem Scheitern des Sozialismus ihr Nationalbewusstsein wiederentdeckt. "Für die Russen dagegen ist nicht nur der Sozialismus gescheitert, sondern auch der Nationalstolz einer Supermacht - zwei ziemlich bittere Erfahrungen gleichzeitig."
Wie unter einem Glassturz und in kleinen Schnappschüssen lässt sich so jenes Jahr besichtigen, in dem Russlands Abwendung vom Westen Fahrt aufgenommen hat. Tatenarm und gedankenvoll, auf Sparflamme, unterhält der Dozent aus Deutschland seine Liebesbeziehung zur tatarischstämmigen Studentin Dilja. Ist er feige? Wer seine Gefühle "maximal kleinhalten" will, wird zur russischen Seele kaum durchdringen. Immerhin hat der Erzähler die Chuzpe, sich auf seiner abschließenden halboffiziellen Reise in den sibirischen Norden von Dilja begleiten zu lassen. Ein Umstand, der die letzten vierzig Seiten des Buchs noch einmal sehr intensiv macht: Der Zug mit dem ungleichen Paar, das sein Versteckspiel und die Last der ruinierten Städte hinter sich lassen kann, rollt gleichsam aus der Welt heraus - in ein anderes Russland. Eines, das nicht die geringsten Anzeichen von Verfall trägt: die schimmernden Öl- und Gasanlagen von Surgut, das hochmoderne, erst seit Mitte der Achtzigerjahre hochgezogene Gubinski, in dem junge, weltläufige Russen bei vierzig Grad minus mit ausgemusterten Armee-Kettenfahrzeugen zum Eisangeln brausen. "Das hat nichts mit Europa zu tun, das ist das neue Russland", erklärt einer von ihnen.
Mit einer Mischung aus Ernüchterung und Beklemmung legt man Martin Gross' Aufzeichnungen, einen Bericht aus Friedenszeiten, aus der Hand. Vieles von dem, was der Autor vor vierundzwanzig Jahren, wie er selbst einschätzt, recht unbekümmert notiert hat, schaut nach der "Zeitenwende" anders aus dem Buch zurück. Damals reiste Gross voller Aufbruchsstimmung nach Russland, es war viel von Hoffnung, Freundschaft, Zukunft die Rede - nadeschda, druschba, buduschtscheje. Heute formuliert er bitter: "Das europäische Haus wird eine Bauruine bleiben." NILS KAHLEFENDT
Martin Gross: "Ein Winter in Jakuschevsk". Roman.
Verlag Sol et Chant,
Letschin 2022. 276 S., geb., 26,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main