Anfang Februar 1781 reist Gotthold Ephraim Lessings Stieftochter Maria Amalia von Wolfenbüttel, wo die Familie lebt, nach Braunschweig zu Lessing, der schwer erkrankt ist. Es steht nicht gut um ihn. Amalia tut, was sie kann, um ihm beizustehen, doch kann sie kaum noch zu ihm durchdringen, verliert er sich doch zusehends im Fieberwahn, verwechselt Amalia mit ihrer Mutter, seiner verstorbenen Ehefrau Eva, und sinniert über Spinoza und seinen »Derwisch«, den er als letzten großen Wurf zu Papier bringen wolle .
Was hat Lessing am Ende umgetrieben? Welche Gedanken gingen ihm kurz vor seinem Tod durch den Kopf? Christoph Hein erzählt eindringlich von den letzten Tagen des bedeutendsten Dichters der Aufklärung.
Was hat Lessing am Ende umgetrieben? Welche Gedanken gingen ihm kurz vor seinem Tod durch den Kopf? Christoph Hein erzählt eindringlich von den letzten Tagen des bedeutendsten Dichters der Aufklärung.

Alle Klippen umschifft: Christoph Hein lässt Lessings Stieftochter von des Dichters letzten Tagen erzählen
Das Los, das Lessing kurz vor seinem Ende zog, war eine Niete. Den Einsatz blieb er seinem Freund Daveson jedoch schuldig, als er am 15. Februar 1781 in dessen Beisein im Braunschweiger Haus der Lotterie verstarb. Neben Daveson waren ein Arzt, Lessings Diener und dessen Stieftochter Maria Amalia anwesend. An sie soll der Dichter seine letzten Worte gerichtet haben: "Sei ruhig, Malchen." Sie war die Tochter von Lessings Frau, die nach nur fünfzehn Monaten Ehe mit ihm im Kindbett gestorben war. Der bei Lessings Tod mittlerweile Sechzehnjährigen sind die meisten Informationen über seine finalen Jahre als Bibliothekar in Wolfenbüttel zu verdanken. Christoph Hein zaubert daraus nun eine kleine, charmante Erzählung in Form eines fiktiven Briefes. Malchen, inzwischen alt geworden und selbst verwitwete Braunschweiger Posträtin, könnte ihn 1842 an die Tochter des einst als Lotterieschwindler angeklagten Daveson geschrieben haben.
Historische Novellen sind ein populäres, aber heikles Genre. Hein entgeht geschickt der doppelten Gefahr, historische Dokumente entweder bloß nachzuerzählen oder über mögliche Pikanterien freizügig zu spekulieren. Er erfindet Zusammenhänge, die das Gefundene nach dichterischer Logik neu erschließen. Lessing, der isolierte Bücherkauz mit magerem Bibliothekarsgehalt, für den Hein sich schon vor der Wende im Essay "Öffentlich arbeiten" interessiert hatte, gewinnt dabei schön an Kontur. Der Alltag mit Malchen, die ihm nach dem Tod seiner Frau den Haushalt führte, wird ins Geistige erweitert: Lessings Philosophieren mit Spinoza oder der Plan zur Fortführung des Derwischs aus dem Drama "Nathan der Weise" kommen ebenso zur Sprache wie der intensive Austausch mit dem Braunschweiger Dichter Leisewitz oder dem Hamburger Theaterleiter Schröder. Natürlich spielt auch das Gerücht einer angeblichen Leidenschaft für die Stieftochter eine Rolle, das die eifersüchtig in Lessing verliebte Elise Reimarus aufgegriffen hatte. Der dementierte es äußerst klug in einem vier Seiten langen Schreiben vom 7. Mai 1780. Hein behandelt dieses vermeintliche Skandälchen taktvoll aus Malchens Perspektive, die sich im ruhigen Duktus ihres eigenen Briefes niemals irritieren lässt. Ihre bildliche Sprache und ihr Sinn für prägnante Details bieten durchaus schöne Anlässe für Illustrationen. Rotraut Susanne Berner greift sie aber leider nicht auf, ihre Falter, Früchte und Flore gehen keine nennenswerte Verbindung mit dem Text ein.
kos
Christoph Hein: "Ein Wort allein für Amalia".
Mit Illustrationen von Rotraut Susanne Berner. Insel Verlag, Berlin 2020. 88 S., geb., 14,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Lothar Müller findet in Christoph Heins Briefroman über Lessings letzte Tage manch verbürgte Szene, brillante Apercus des Dichters über sein Leben und die Literatur sowie die Krankengeschichte bis zum Tod und auch einen späten Traum Lessings von der Radikalisierung der Aufklärung. Wie der Autor all das aus dem "Binnenraum der Erinnerung" der Tochter Amalia heraus erzählt und Zitate und Briefstellen Lessings einbindet, findet Müller erfrischend, lesenswert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Christoph Hein zaubert ... eine kleine, charmante Erzählung in Form eines fiktiven Briefes.« Frankfurter Allgemeine Zeitung 20200618

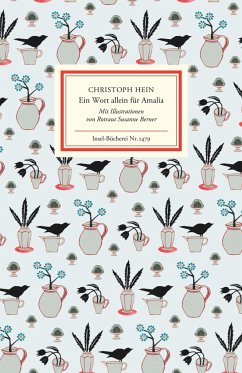





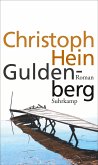
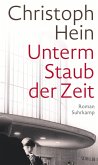


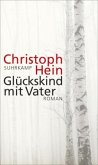
heike-s.jpg)