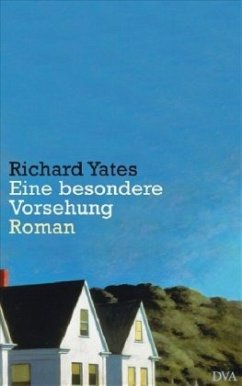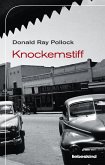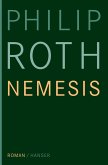Alice ist überzeugt, das Leben halte etwas ganz Besonderes für sie und ihren Sohn Robert bereit - als Künstlerin wird sie Anerkennung finden und ihr Bobby die Privatschule abschließen. Doch wie so oft kommt alles ganz anders als geplant...
Richard Yates, ein Meister der klaren Worte, spiegelt in '"Eine besondere Vorsehung" aufs Neue mit lakonischer Schärfe die Schattenseiten des amerikanischen Traums.
Robert Prentice ist das Ein und Alles seiner Mutter Alice. Ihm, dem sie einst mit einer Statue ein Denkmal setzte, hat die Bildhauerin ihren bisher einzigen Kritikererfolg zu verdanken. Und mit seiner Hilfe - so viel ist sicher! - wird sie irgendwann künstlerische Anerkennung erzielen. Doch plötzlich steht sie allein da mit ihren Fantasien von einem glamourösen Künstlerleben, denn Robert meldet sich zum Militär und geht nach Europa, um auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs zu Ruhm und Ehre zu gelangen.
Eine herzzerreißende Geschichte über eine von einseitigen Abhängigkeiten geprägte Mutter-Sohn-Beziehung und die Illusionen, die ein junger Mann sich über den Krieg macht - und gleichzeitig das Sittengemälde einer Gesellschaft, die von sozialer Härte und dem fruchtlosen Streben nach Idealen gekennzeichnet ist. Ein weiterer grandioser Roman von Richard Yates, "einem der wichtigsten amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts" (FAZ).
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Richard Yates, ein Meister der klaren Worte, spiegelt in '"Eine besondere Vorsehung" aufs Neue mit lakonischer Schärfe die Schattenseiten des amerikanischen Traums.
Robert Prentice ist das Ein und Alles seiner Mutter Alice. Ihm, dem sie einst mit einer Statue ein Denkmal setzte, hat die Bildhauerin ihren bisher einzigen Kritikererfolg zu verdanken. Und mit seiner Hilfe - so viel ist sicher! - wird sie irgendwann künstlerische Anerkennung erzielen. Doch plötzlich steht sie allein da mit ihren Fantasien von einem glamourösen Künstlerleben, denn Robert meldet sich zum Militär und geht nach Europa, um auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs zu Ruhm und Ehre zu gelangen.
Eine herzzerreißende Geschichte über eine von einseitigen Abhängigkeiten geprägte Mutter-Sohn-Beziehung und die Illusionen, die ein junger Mann sich über den Krieg macht - und gleichzeitig das Sittengemälde einer Gesellschaft, die von sozialer Härte und dem fruchtlosen Streben nach Idealen gekennzeichnet ist. Ein weiterer grandioser Roman von Richard Yates, "einem der wichtigsten amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts" (FAZ).
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Richard Yates schickt einen Soldaten als hoffnungslosen Muttersohn in den Krieg / Von Peter Körte
Sie liegt einfach in der Luft, man atmet sie unwillkürlich ein beim Lesen, schon auf der ersten Seite: diese leise Traurigkeit, diesen Anflug von Resignation, die in den Büchern von Richard Yates zur Atmosphäre gehören und die seine Charaktere oft gar nicht spüren, weil sie so voller Zuversicht, Optimismus und voller Träume sind, dass sie die Kluft gar nicht bemerken, die zwischen Wünschen und Wirklichkeit liegt.
Der junge GI Robert Prentice besucht 1944 noch einmal seine Mutter Alice in New York, kurz bevor er nach Europa in den Krieg muss. Er wirkt verloren, wenn er in der Penn Station ankommt, fast teilnahmslos, wenn er mit seiner Mutter in ein billiges Restaurant in der Nähe des Columbus Circle geht; sie stochern in den Hähnchenkroketten, verzichten auf ein Menü, um sich noch einen Manhattan leisten zu können. In ihrer Zweisamkeit liegt eine eigenartige Spannung aus dem Wunsch nach Nähe und der Unfähigkeit, sie herzustellen; da ist ein Hauch von Vergeblichkeit, der nicht bloß aus Roberts Angst vor der Front kommt. Und wären nicht die Gemälde von Edward Hopper so kunstvoll ausgeleuchtet, wäre nicht die Einsamkeit in ihnen so tröstlich-perfekt inszeniert, man könnte an sie denken. Doch Yates' Welt ist grauer, und die Farben wirken blasser.
Der Roman "Eine besondere Vorsehung" ("A Special Providence") ist vor fast vierzig Jahren in Amerika erschienen. Der Titel hat schon einen seltsamen Klang, weil der Begriff "Vorsehung" eigentlich kein Attribut braucht, allenfalls käme noch der Zusatz "göttliche" in Frage. 1969 stand Yates nach seinem Erstling "Revolutionary Road" ("Zeiten des Aufruhrs") bereits im Halbschatten des Literaturbetriebs, und es hat auch nicht allzu viel geholfen, dass Autoren wie Raymond Carver, Richard Ford oder Joyce Carol Oates später erklärten, wie viel sie ihm verdankten. Er ist aus den Buchläden verschwunden.
Seine Bücher waren einfach zu ernüchternd für die sechziger Jahre; die späten vierziger und die fünfziger Jahre, Amerikas Zeitalter der Unschuld, wirkten in seinen Beschreibungen zu trist, sie waren entzaubert, und man kann auch nicht ausschließen, dass Yates, der 1992 im Alter von sechsundsechzig Jahren starb, das geahnt hat. Denn einem, der als Journalist begann und später dann auch Reden für Robert Kennedy schrieb, wird kaum entgangen sein, dass die zerbrochenen Träume und verlorenen Illusionen in seiner Prosa mit der Aufbruchsstimmung der Sixties nur sehr schwer in Einklang zu bringen waren. Und vielleicht sind die Romane und Erzählungen von Richard Yates so etwas wie die Kehrseite, der lange Schatten dieser Stimmung, weil sie ganz ruhig, ganz unaufgeregt auf die Kindheit der Baby Boomer zurückschauen, aus der sich diese später befreien wollten und doch nicht recht konnten.
Auch in "Eine besondere Vorsehung" fällt nichts langsam auseinander im Prozess einer allmählichen Desillusionierung; es ist im Grunde schon zerfallen, wenn das Buch beginnt. Der Roman wechselt zwischen Alices und Roberts Perspektive, zwischen den Schlachtfeldern in Frankreich und Deutschland, wo Yates selbst war, und dem mühsamen Alltag einer alternden Frau, die so gerne eine erfolgreiche Bildhauerin geworden wäre, den Traum vom Durchbruch nicht aufgegeben hat - und ihren Lebensunterhalt in einer Fabrik verdienen muss. Ein Epilog aus dem Jahr 1946 beschließt das Buch: eine Frau von Mitte fünfzig, ein junger Mann von zwanzig Jahren, Mutter und Sohn, zwei Wege, die jäh abbrechen, nachdem man ihnen durch die Jahre gefolgt ist.
Robert hat kurz vom Heldentum geträumt und ist nach der Überquerung des Rheins mit einer Lungenentzündung im Lazarett gelandet. Zu erobern blieb danach nicht mehr viel, er hat sich auch ein bisschen dumm angestellt in der Truppe, der einzige Freund, den er gefunden hatte, ist gefallen. Es bleibt vage, was er will, die Vorwürfe, die er sich selbst macht, sind in ihrer Verstiegenheit hilflos. Er fällt nicht ganz heraus aus der Gemeinschaft, aber er fügt sich auch nicht wirklich ein, sosehr er dazugehören möchte. Zum Outsider fehlt ihm die rebellische Energie.
Die Passagen, in denen Alices Perspektive dominiert, bilden den Zickzackkurs eines Lebens nach, das so deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt, dass sie es sich gar nicht eingestehen kann, ohne vollends zu verzweifeln. Die dauernden Umzüge, die gescheiterte Ehe, die Hoffnungen auf eine Familie und auf künstlerische Anerkennung, dann der Brite mit Stil und Wärme, der nur auf Geschäftsreise gehen wollte, der nie zurückkam und sie mit imponierenden alten Möbeln zurückließ, für die der Trödler dann doch nur hundert Dollar bot. Die Lakonie, mit der Yates das beschreibt, hat bisweilen etwas ungeheuer Schmerzliches, weil das Buch an Alices euphorischen Schüben teilnimmt, an ihren Aufwallungen von grundlosem Optimismus und ihrem Glauben an die Wende zum Guten, noch dann, wenn sie bei ihrer jüngferlichen Schwester und deren trinkendem Ehemann in Texas sitzt, ohne Geld, ohne Aussichten, mit einem Kind, das längst den Glauben an seine Mutter verloren hat, ohne sich das eingestehen zu können.
Richard Yates findet dafür einen ruhigen, klaren Ton, nicht mitleidig, auch nicht anklagend, und gerade weil er sich nicht anstrengt, etwas Besonderes, Exemplarisches aus diesen Lebenswegen herauszupressen, wird die Wahrscheinlichkeit desto größer, dass er von Lebensläufen und Begebenheiten erzählt, die viel exemplarischer waren als all die hoffnungsfrohen Bilder, die aus dem Amerika dieser Jahre überliefert sind.
Das Menschenfreundliche an Yates' Roman - und nicht nur an diesem - ist die seltene Fähigkeit, von Menschen zu erzählen, die sich fortlaufend über ihre Möglichkeiten täuschen und die hartnäckig an ihren Vorstellungen von der Welt festhalten, ohne ihnen alle Sympathie zu entziehen oder sie zu denunzieren in ihrer unbewussten Weltflüchtigkeit. Es braucht keine tragische Zuspitzung, keine enorme Fallhöhe, aus der sonst Helden stürzen. Wovon dieser Roman, ebenso wie all die anderen von Richard Yates, handelt, das ist die Selbstverkennung, die eine Weile als Selbstschutz ganz passabel funktioniert; es ist die Resistenz gegen Enttäuschungen, die allmählich so abgetragen und fadenscheinig wirkt wie Alices schwarzes Seidenkleid. "Wir tun einfach so, als ob es nicht so wäre", sagt sie zu ihrem Sohn, wie man das eben zu Kindern sagt - nur dass sie selbst fest an diese Beschwichtigungsformel glaubt. Wenn das so einfach wäre, müssten wir uns die Helden in Richard Yates' Romanen als glückliche Menschen vorstellen.
Richard Yates: "Eine besondere Vorsehung". Roman. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Anette Grube. Deutsche Verlagsanstalt, München 2008. 392 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Rezensent Thomas David freut sich über die Wiederentdeckung des amerikanischen Schriftstellers Richard Yates. Und über diese deutsche Ausgabe des vor knapp vierzig Jahren im Original erschienenen Romans, der Davids Information zufolge von einem jungen Amerikaner handelt, der 1944 als Soldat in den Zweiten Weltkrieg eintritt. Die Art, wie der junge, gänzlich unheroische Prentice hier als Spielball höherer Mächte und einer höchst dominanten Mutter geschildert wird, findet der Rezensent ausgesprochen stark. Auch, weil die höheren Mächte des Jahrhunderts samt ihrer fatalen Auswirkungen höchst plastisch geschildert sind. In wenigen Momenten kritisiert David am Erzählverlauf eine gewisse "Eilfertigkeit". Insgesamt jedoch fasziniert ihn diese Mutter-Sohn-Geschichte als Geschichte einer Abhängigkeit, aus der der Protagonist erst in der zerstörerischen Atmosphäre des Krieges Befreiung findet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein Meister der Sprache. Klar und messerscharf: Kein Wort ist zuviel und trotzdem ist alles gesagt.« Bayerischer Rundfunk