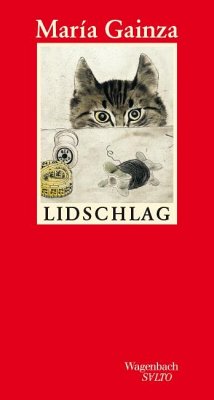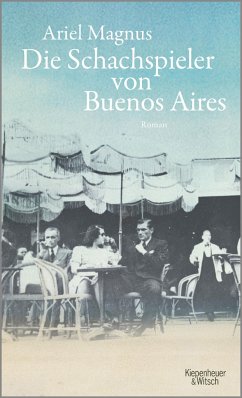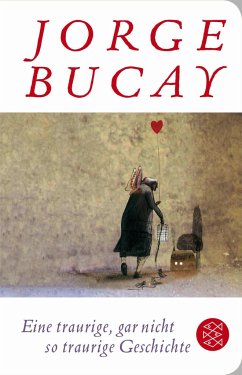Eine Episode im Leben des Reisemalers

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Der Augsburger Maler Johann Moritz Rugendas erreicht 1837 zusammen mit dem Maler Robert Krause Lateinamerika. Als Landschafts- und Naturmaler soll er die Forschungen des Entdeckers durch Illustrationen unterstützen. Auf dem Weg von Chile nach Buenos Aires passieren sie einen unheimlich anmutenden Landstrich, bald zieht ein nachtschwarzes Gewitter auf und entlädt sich über ihnen. Rugendas wird vom Blitz getroffen. Er überlebt, doch er verfängt sich im Steigbügel und das erschreckte Pferd bricht aus und schleift ihn mit sich. Auch diese Tortur überlebt er, aber sein Gesicht wird aufs Für...
Der Augsburger Maler Johann Moritz Rugendas erreicht 1837 zusammen mit dem Maler Robert Krause Lateinamerika. Als Landschafts- und Naturmaler soll er die Forschungen des Entdeckers durch Illustrationen unterstützen. Auf dem Weg von Chile nach Buenos Aires passieren sie einen unheimlich anmutenden Landstrich, bald zieht ein nachtschwarzes Gewitter auf und entlädt sich über ihnen. Rugendas wird vom Blitz getroffen. Er überlebt, doch er verfängt sich im Steigbügel und das erschreckte Pferd bricht aus und schleift ihn mit sich. Auch diese Tortur überlebt er, aber sein Gesicht wird aufs Fürchterlichste entstellt. Von nun an im Morphiumrausch, um die Schmerzen zu ertragen, malt er Bilder von atemberaubender Wucht. Auf seiner Jagd nach immer spektakuläreren Motiven wagt er sich eines Tages ins Zentrum eines echten Indianer überfalls, doch diesmal scheint seine Obsession zu weit zu gehen.