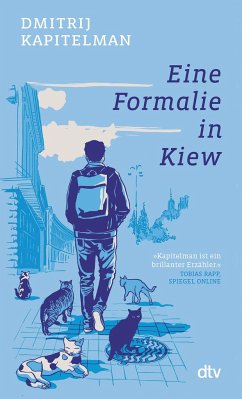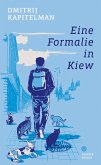Eine berührende Liebeserklärung an Heimat und Familie
Dmitrij Kapitelman kann besser sächseln als die Beamtin, bei der er den deutschen Pass beantragt. Nach 25 Jahren als Landsmann, dem Großteil seines Lebens. Aber der Bürokratie ist keine Formalie zu klein, wenn es um Einwanderer geht. Frau Kunze verlangt eine Apostille aus Kiew. Also reist er in seine Geburtsstadt, mit der ihn nichts außer Kindheitserinnerungen verbindet. Schön sind diese Erinnerungen, warten doch darin liebende, unfehlbare Eltern. Und schwer, denn gegenwärtig ist die Familie zerstritten. 'Eine Formalie in Kiew' ist die Geschichte einer Familie, die einst voller Hoffnung in die Fremde zog und am Ende ohne jede Heimat dasteht. Erzählt mit dem bittersüßen Humor eines Sohnes, der stoisch versucht, Deutscher zu werden.
Dmitrij Kapitelman kann besser sächseln als die Beamtin, bei der er den deutschen Pass beantragt. Nach 25 Jahren als Landsmann, dem Großteil seines Lebens. Aber der Bürokratie ist keine Formalie zu klein, wenn es um Einwanderer geht. Frau Kunze verlangt eine Apostille aus Kiew. Also reist er in seine Geburtsstadt, mit der ihn nichts außer Kindheitserinnerungen verbindet. Schön sind diese Erinnerungen, warten doch darin liebende, unfehlbare Eltern. Und schwer, denn gegenwärtig ist die Familie zerstritten. 'Eine Formalie in Kiew' ist die Geschichte einer Familie, die einst voller Hoffnung in die Fremde zog und am Ende ohne jede Heimat dasteht. Erzählt mit dem bittersüßen Humor eines Sohnes, der stoisch versucht, Deutscher zu werden.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensentin Sonja Zekri erfährt bei Dmitrij Kapitelman, dass die Grenzen zwischen den Zugehörigkeiten fließend sind. Was Kapitelman als Sohn ukrainischer Einwanderer in Deutschland erlebt und was als ukrainischstämmiger Deutscher zurück in Kiew, liest sie mit Lust und Gewinn. Dazu tragen Kapitelmans Wortschöpfungen bei ("übersprunghandeln") und seine Auseinandersetzungen mit den Eltern und den bestechlichen Kiewer Behörden. Wie kulturelle Traditionen die Realität von Migranten ausdauernd prägen, lernt Zekri bei Kapitelman auf anekdotische Weise.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Dmitrij Kapitelman erzählt in "Eine Formalie in Kiew" auf höchst amüsante Weise von ewiger Flucht
In Leipzig gibt es ein russisches Spezialitätengeschäft namens "Magasin" (das russische Wort für ein Ladenlokal), an dem ich häufig vorbeigekommen bin. Als vor fünf Jahren Dmitrij Kapitelmans Debüt "Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters" erschien, die umwerfend komische Schilderung einer gemeinsamen Reise von Vater und Sohn nach Israel, konnte man darin auch erfahren, dass seine Eltern nach ihrer Ausreise aus der Ukraine im Jahr 1994 ein Geschäft mit dem Namen "Magasin" in Leipzig eröffnet hatten. Seitdem ging ich mit erneuertem Interesse am Schaufenster vorbei, bestaunte fortan allerdings eher die Betreiber als die Auslagen - was einiges heißen will, schließlich war unter Letzteren lange Zeit auch eine wodkagefüllte gläserne Kalaschnikow in Originalgröße. Kapitelmans Publikation aber habe ich nie dort ausliegen gesehen. Dann schloss das Geschäft, und es zog eine Buchhandlung ein. Ironie des Schicksals?
Nun hat Kapitelman sein zweites Buch veröffentlicht: wieder eine Reiseschilderung, wieder ist er gemeinsam mit seinem Vater unterwegs, wieder ist es urkomisch, und wieder erfährt man auch manches über die Leipziger Jugend des Autors. Und doch ist diesmal vieles anders. War die Israel-Fahrt eine späte Reise auf den Spuren eines schon früh gescheiterten Plans - Kapitelmans Vater ist Jude, entschied sich aber 1994 aus praktikablen Gründen (Kapitelmans Mutter ist keine Jüdin) für Deutschland als Auswanderungsziel -, war der 2019 durchgeführte Ausflug nach Kiew eine Heimkehr: Hier wurde Dmitrij Kapitelman 1986 geboren. Doch die Rückkehr mehr als drei Jahrzehnte später hatte keinen sentimentalen Anlass, sondern musste erfolgen, um eine Bescheinigung der dortigen Behörden zu erhalten, die für die Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft nötig ist. "Joa", sagt Frau Kunze, Kapitelmans Sachbearbeiterin im Leipziger Einwohnermeldeamt in schön transkribiertem Sächsisch, "üm den Ümgang mid den ukrainisch'n Behörd'n beneide ich Sie ooch nisch." Wie man dann im Laufe von 176 Seiten erfährt, war das noch eher euphemistisch ausgedrückt.
Es geht Kapitelman stark ums Sprachliche. Nicht nur, dass er sächsischen Zungenschlag gut schriftlich zu imitieren weiß, er liefert in seinem Buch auch eine Sprachphänomenologie des Postsozialismus. Und das nicht in platt denunziatorischer Weise, sondern satirisch zugespitzt vor allem über seine Eigenschaft als Doppelsprachler: Acht Lebensjahre in Kiew haben für die Beherrschung des Russischen gesorgt und danach ein Vierteljahrhundert in Deutschland für dessen Vernachlässigung, die nun bei der Wiederauffrischung konstruktives Befremden auslöst. Paradebeispiel im Buch ist die Wendung "Obtlagodari", ein Synonym für Bestechung, das Kapitelman wörtlich mit "Man entdankt sich" übersetzt. Aus diesem deutschen Neologismus macht er einen Running Gag seines Kiewer Aufenthalts und sorgt damit selbst für eine positive Form der Bereicherung: Seine hiesigen Leser dürften kaum umhinkommen, "entdanken" in ihren Wortschatz aufzunehmen.
Und nachzudenken über ähnliche, ihnen aber altvertraute und somit gar nicht fragliche Wendungen der eigenen Sprache wie etwa "entsorgen". "Ja okay", schreibt Kapitelman im typisch mündlichen Erzählduktus seines Buchs, "die Landsleute hier kennen den Ausdruck entsorgen überhaupt nicht." Hier - das bedeutet diesmal in der Ukraine. Und man kann sich vorstellen, wie diese Landsleute staunen würden, wenn Kapitelman ihnen wiederum das deutsche Wort "entsorgen" wörtlich übersetzte.
So dient "Eine Formalie in Kiew" auf höchst intelligente Weise der Völkerverständigung - im buchstäblichen Sinne. Obwohl das Buch voller Klischees steckt, deren Richtigkeit es aber lustvoll zu belegen versteht. Kein Geringerer als der Philosoph Hans-Georg Gadamer hat ja das Vorurteil zur Grundlage seiner Hermeneutik, der Lehre vom Verstehen, gemacht. Kapitelman erweist sich als gelehriger Schüler. Und die gern in den Text eingeworfene Formulierung "Außer uns gesprochen", mit der Kapitelman sein exklusives Wissen übers Russische gegenüber uns, seinen Lesern und künftigen Landsleuten (denn am Ende wartet er immer noch auf seine Bescheinigung), ausstellt, bietet eine ähnlich produktive Befremdung.
Dieser Blick auf die Sprache ist ein furioser Beitrag zur sogenannten Migrantenliteratur, die mittlerweile eine Schlagader im Blutkreislauf der deutschsprachigen Literatur geworden ist. "Ja, ich flüchte mich in Sprachspielereien", schreibt Kapitelman, dessen Familie 1994 den Status von "Kontingentflüchtlingen" hatte. Der Sohn hat mit dem Flüchten einfach weitergemacht: "Migration hört eigentlich nie auf", heißt es einmal. Aber mit im Gepäck hat Kapitelman sein bilinguales Sprachbesteck, und in die Autorenreihe von Feridun Zaimoglu bis Sasa Stanisic, die uns mit solchem Besteck geistreich neue Sprachmanieren und -manierismen nahegebracht hat, passt sich "Eine Formalie in Kiew" nahtlos ein.
Wie aber kommt beim ukrainischen Wortspiel und Behördengang noch Kapitelmans Vater mit ins Spiel? Er wird von der resoluten Mutter, der diesmal eine weitaus größere Rolle zugeschlagen wird als im Vorgängerbuch, gleichzeitig zur medizinischen Behandlung nach Kiew geschickt, weil dort trotz "Entdankung" alles billiger sei. Die Tour d'hôpital, die Leonid Kapitelman absolviert, spottet jeder Beschreibung, aber sein Sohn schafft es, aus dem persönlichen Drama, das ihr zugrunde liegt, eine gloriose Farce zu machen. Immerhin kommt Leonid Kapitelman wieder heil aus dem Land heraus und wird sogar im Leipziger "Magasin" kurzfristig wieder an der Kasse sitzen.
Das aber steht schon nicht mehr im Buch. Wie auch im Falle anderer Reiseimpressionen aus Kiew - etwa einer kurzen Taxiepisode für die Schweizer Zweimonatszeitschrift "Reportagen" (Heft 56, Januar 2021) -, erfährt man das Ende der Kapitelman'schen Expedition anderswo, diesmal im "Spiegel". Dort veröffentlichte Dmitrij Kapitelman schon im vergangenen Juli eine Reportage über seinen Versuch, das Geschäft der Eltern durch die Corona-Krise zu bringen. Leider war er erfolglos. Doch Moment - war denn das Leipziger "Magasin" nicht schon vorher vom Buchladen abgelöst worden? Plötzlich begreife ich, dass ich jahrelang am falschen "Magasin" vorbeigelaufen bin und bei dessen Schließung gar nicht das der Kapitelmans betrauert habe. Und doch: Wenn das neue Buch es ins Schaufenster des anderen ehemaligen "Magasin" schaffen sollte, dann wird mir das wie eine weitere höchst gelungene Heimkehr des Dmitrij Kapitelman vorkommen.
ANDREAS PLATTHAUS
Dmitrij Kapitelman:
"Eine Formalie in Kiew".
Hanser Berlin Verlag, Berlin 2021. 176 S., geb., 20,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Keiner kann wie Dmitrij Kapitelman neue Begriffe erfinden, unvergleichlich ist seine melancholische Leichtigkeit, mit der er tieftraurige Dinge erzählen kann." Brigitte Bücher Sonderheft, 2/2021 "Die Zärtlichkeit mit der Kapitelman seine Figuren zeichnet, ist berührend. ... Eine kurzweilige und angenehme Lektüre ist dieses Buch, das uns einer beiläufigen Schönheit schildert, wie eine Familie letztendlich auch in all ihrer Heimatlosigkeit beieinander bleiben und neu zueinander finden kann." Jonathan Böhm, SWR 2, 08.06.21 "Kapitelman ist ein brillanter Erzähler, lustig, selbstironisch und mit klarem Blick. Eine Formalie in Kiew erzählt davon, wie nah die Ukraine Europa eigentlich ist." Tobias Rapp, Spiegel online, 07.03.22 "Tragisches und Komisches sind ganz nah beieinander. Ein junges, frisches Buch und ein schönes Plädoyer für mehr Menschlichkeit und weniger Bürokratie." Melanie Fischer, Deutschlandfunk Kultur Lesart, 07.05.21 "Kapitelman hat einen wachen Blick und beweist in seinem Roman eine enorme Beobachtungsgabe. Dieses Buch zu lesen ist ein großes Vergnügen. ... ein großes Sprachtalent." WDR 2, 10.03.21 "Kapitelman verhandelt .. ein Bewusstsein für die Fluidität von Zugehörigkeiten, den Wandel und das Nebeneinander von Identitäten, für Widersprüche, die nur von außen wie Widersprüche wirken." Sonja Zekri, Süddeutsche Zeitung, 06.03.21 "Das ist ungeheuer liebevoll ... es ist so, dass es einem die Tränen der Rührung in die Augen treibt. Man möchte diesem Autor danken für diesen wunderschönen Text." Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur, 02.03.21 "Es liest sich gut weg. Kapitelmann ... hat einen hat einen eingängigen Sound, den bewies er schon im wunderbaren Debüt "Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters". Auch in der "Formalie" findet er an der richtigen Stelle zärtliche Worte." Andreas Scheiner, Neue Zürcher Zeitung am Sonntag, 28.02.21 "Ein sprachliches Feuerwerk. ... Dmitrij Kapitelman erzählt mit viel Humor und sprachlicher Fantasie ... immer wieder erfrischend selbstironisch. ... Er vermittelt auf eindrückliche Weise die prekäre Situation des zwischen den Stühlen sitzenden Migranten, der dazu noch von den ambivalenten Gefühlen gegenüber seinen Eltern gebeutelt wird." Fokke Joel, Die Tageszeitung, 22.02.21 "Zum Heulen witzig ... Dieses Buch nimmt mit auf eine sehr persönliche Reise in ein Land, das allen Klischees widerspricht, um einige dann doch, aber anders als erwartet, zu bestätigen. Es führt in eine vieldeutige Sprachwelt ein ... und ist vor allem eine Einladung zum Dialog." Natascha Freundel, rbb Kulturradio, 09.02.21 "Solche Passagen, wie sie Kapitelman gelingen, kann kaum ein Gegenwartsautor in dieser heiteren Anmut und Zärtlichkeit unserer Sprache entlocken. ... Man begleitet diesen Helden und lässt sich verzaubern von einem schier unverwüstlich wirkenden Glauben an Menschlichkeit." Annemarie Stoltenberg, NDR Kultur, 02.02.21 "Kapitelman erzählt voller Witz, Wärme und Esprit. ... Dmitrij Kapitelman schreibt witzig wie Sasa Stanisic, zärtlich-sentimental wie Joseph Roth und ethnografisch genau wie Emilia Smechowski." Marc Reichwein, Die Welt, 30.01.21 "Lehrreich, vor allem aber mit einem wunderbaren Humor beschrieben. Das macht stilistisch Freude, ist wortgewandt und gedankentief." Matthias Schmidt, MDR Kultur, 27.01.21 "Es geht Kapitelman stark ums Sprachliche. Nicht nur, dass er sächsischen Zungenschlag gut schriftlich zu imitieren weiß, er liefert in seinem Buch auch eine Sprachphänomenologie des Postsozialismus. Und das nicht in platt denunziatorischer Weise, sondern satirisch zugespitzt vor allem über seine Eigenschaft als Doppelsprachler: ... So dient "Eine Formalie in Kiew" auf höchst intelligente Weise der Völkerverständigung - im buchstäblichen Sinne. Obwohl das Buch voller Klischees steckt, deren Richtigkeit es aber lustvoll zu belegen versteht." Andreas Platthaus, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.01.21 "Kapitelman stößt eine Lachluke auf, durch die Licht in die düsteren Debatten unserer Zeit dringt. ... Er hat ein zärtliches Buch geschrieben: zärtlich seiner alten Heimat gegenüber und seiner neuen, seinem Vaterland und seiner Muttersprache, seinem Papa und seiner Mama. Ein Buch mit zärtlichem Humor vor allem, jeder Witz eine Liebkosung. Eine große Eltern-Sohn-Liebesgeschichte, ein Plädoyer für mehr Herz und weniger Formalien." Tobias Becker, Spiegel Online, 25.01.21 "Ein wunderbar tragisch-komisches Buch über die Auswirkungen von Migration." Mareike Ilsemann, WDR5, 23.01.21 "Dmitrij Kapitelman erzählt seelenvoll und produziert doch in keinem Moment Kitsch. Sein Roman ist eine 'schmerzsozialisierte', dabei unverhohlen zärtliche Liebeserklärung an ein Elternpaar, dem es nicht gegeben war, in Deutschland heimisch zu werden. Dass Nationalitäten etwas Gleichgültiges sind und nicht wert, Bindungen zu ruinieren, ist das Resümee der meisterhaft unbeschwert erzählten und doch so traurigen Geschichte." Sigrid Brinkmann, Deutschlandfunk Kultur, 21.01.21