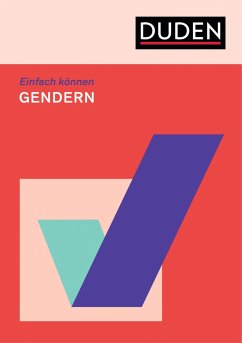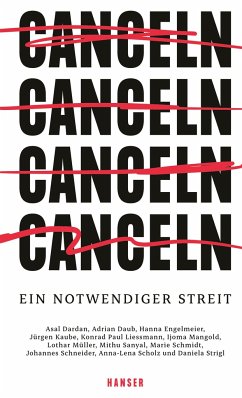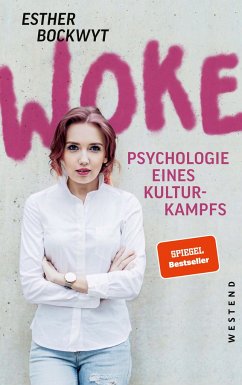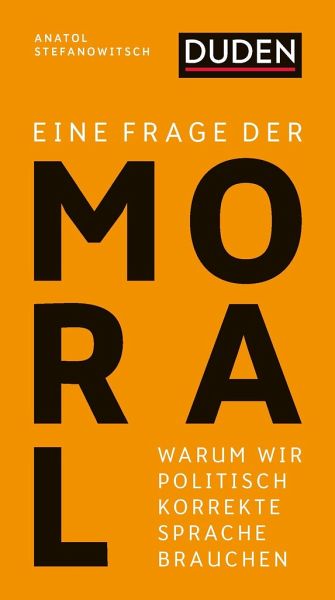
Eine Frage der Moral
Warum wir politisch korrekte Sprache brauchen

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
"Sprachpolizei", "Moralapostel", "Genderkrampf" - warum erhitzen sich die Gemüter so an Political Correctness? Warum protestieren Menschen gegen die Bekämpfung von sexistischem und rassistischem Sprachgebrauch? Der Sprachwissenschaftler und Blogger Anatol Stefanowitsch analysiert aufgeheizte Debatten der letzten Jahre: "Gerechte Sprache allein schafft noch keine gerechte Welt. Aber indem wir sie verwenden, zeigen wir, dass wir eine gerechte Welt überhaupt wollen."