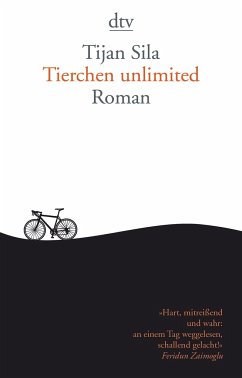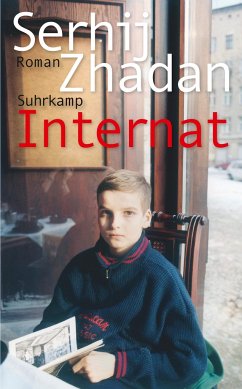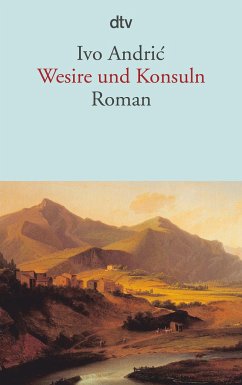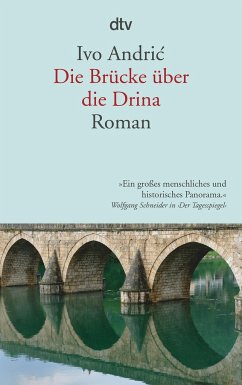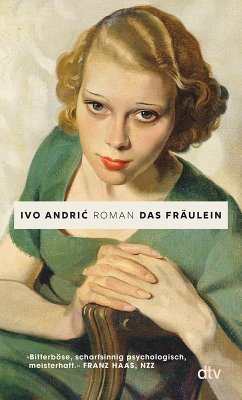Eine Frau besorgen
Kriegsgeschichten. 40 Jahre edition suhrkamp
Übersetzung: Eisterer, Heinrich; Mora, Terézia; Relle, Agnes
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
16,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Im Frühjahr 1999, nach der Beendigung seines Romans Die Legende von den Tränengauklern, kehrte Darvasi zu seiner ursprünglichen, der kurzen Prosaform zurück. Unter dem Eindruck der Vertreibungen im Kosovo und der Bombardierung Serbiens entstand ein Zyklus von Erzählungen, die zum Besten, aber auch Bittersten gehören, was er bisher geschrieben hat. Das Buch spielt während des Bosnien-Krieges und danach, an teilweise imaginären Orten zwischen Sarajevo, dem Amselfeld und der serbischen Batschka, in einem Klima totaler Verwilderung, Gesetzlosigkeit und Grausamkeit. Söhne erschießen ihre ...
Im Frühjahr 1999, nach der Beendigung seines Romans Die Legende von den Tränengauklern, kehrte Darvasi zu seiner ursprünglichen, der kurzen Prosaform zurück. Unter dem Eindruck der Vertreibungen im Kosovo und der Bombardierung Serbiens entstand ein Zyklus von Erzählungen, die zum Besten, aber auch Bittersten gehören, was er bisher geschrieben hat. Das Buch spielt während des Bosnien-Krieges und danach, an teilweise imaginären Orten zwischen Sarajevo, dem Amselfeld und der serbischen Batschka, in einem Klima totaler Verwilderung, Gesetzlosigkeit und Grausamkeit. Söhne erschießen ihre Väter, vergehen sich an Minderjährigen und Toten. Das Besorgen von Frauen gehorcht einem animalischen Überlebenstrieb. Doch die Frauen mit so seltsamen Namen wie Rosalia Fugger-Schmidt oder Julia Sunce sind nicht nur Opfer, sondern auch souveräne Schönheiten, die mit Prothesen handeln oder wochenlang schlafen können. Immer wieder ins Surreale kippend, erzählt Darvasi in diesen unheimlichen Geschichten vom extremen Zustand andauernder Gewalt.
((bitte rechtsbündig)) Foto: Renate von Mangoldt
((bitte rechtsbündig)) Foto: Renate von Mangoldt