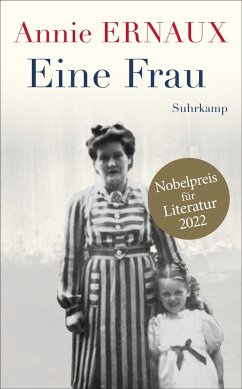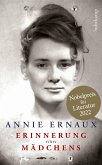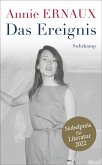Nobelpreis für Literatur 2022
Dreizehn Tage nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1986 schreibt Annie Ernaux ein kurzes, schmerzhaftes Requiem. Und lässt die Mutter als Repräsentantin einer Zeit und eines Milieus auferstehen, das auch das ihre war.
Das Leben ihrer Mutter: geboren um die Jahrhundertwende in der Normandie, Arbeiterin, dann Ladenbesitzerin, Ehefrau, zweifache Mutter, lebenslustig und offen, Körper und Geist werden später langsam durch Alzheimer zerstört. Das Ende war für die Tochter vorauszusehen, die Wirklichkeit des Todes scheint indessen kaum erträglich. Zeit ihres Lebens kämpfte die Mutter darum, ihren sozialen Status zu erhalten, ihn vielleicht sogar zu überwinden. Erst der Tochter wird dies gelingen, eine Distanz zwischen den beiden entsteht. Auch darauf blickt Annie Ernaux zurück, voller Zärtlichkeit und Abscheu und Schuldgefühl.
Dreizehn Tage nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1986 schreibt Annie Ernaux ein kurzes, schmerzhaftes Requiem. Und lässt die Mutter als Repräsentantin einer Zeit und eines Milieus auferstehen, das auch das ihre war.
Das Leben ihrer Mutter: geboren um die Jahrhundertwende in der Normandie, Arbeiterin, dann Ladenbesitzerin, Ehefrau, zweifache Mutter, lebenslustig und offen, Körper und Geist werden später langsam durch Alzheimer zerstört. Das Ende war für die Tochter vorauszusehen, die Wirklichkeit des Todes scheint indessen kaum erträglich. Zeit ihres Lebens kämpfte die Mutter darum, ihren sozialen Status zu erhalten, ihn vielleicht sogar zu überwinden. Erst der Tochter wird dies gelingen, eine Distanz zwischen den beiden entsteht. Auch darauf blickt Annie Ernaux zurück, voller Zärtlichkeit und Abscheu und Schuldgefühl.
»Keine kann die biografische Analyse so sensibel wie Annie Ernaux.« Antonia Groß Berliner Zeitung 20220705

Entlarvend und zärtlich zugleich: In "Eine Frau" erzählt Annie Ernaux über ihre Herkunftsgefühle.
Von Sandra Kegel
Das ist mutig, über die eigene Mutter zu schreiben, die erst wenige Tage zuvor gestorben ist. Nicht abzuwarten, bis sich der erste große Schmerz gelegt hat und Abstand gewonnen ist, sondern mitten hineinzugehen in die Wunde, die sich nicht mehr schließen lässt. Die nunmehr Abwesende war für die Tochter immer ein Mensch ohne Geschichte, weil sie ja immer schon da war. Jetzt muss die Tochter sich zurechtfinden ohne den Schutz der Tapferen, die am Ende ihres Lebens so schwach geworden war. "Ich werde ihre Stimme nie mehr hören", schreibt Annie Ernaux: "Sie, ihre Worte, ihre Hände, ihre Gesten, ihr Gang und ihre Art zu lachen waren es, die die Frau, die ich heute bin, mit dem Kind, das ich gewesen bin, verbunden haben. Ich habe die letzte Brücke zu der Welt, aus der ich stamme, verloren."
Annie Ernaux, 1940 in der Normandie geboren, gehört zu den wichtigsten Schriftstellerinnen Frankreichs. Ihr Werk in der deutschen Übersetzung von Sonja Finck sorgt aber inzwischen auch hierzulande für Aufsehen - wenn auch meist mit Abstand zu den Originalveröffentlichungen. Nach "Der Platz" über ihren Vater und "Erinnerung eines Mädchens" erscheint nun mit "Eine Frau" die Neuübersetzung eines in Frankreich bereits 1987 erschienenen Texts. Trotz dieser zeitlichen Distanz von mehr als dreißig Jahren hat die gerade einmal neunzig Seiten umfassende Ich-Erzählung ohne Genrebezeichnung nichts von ihrer Dringlichkeit verloren. Sie verhandelt Themen, die Annie Ernaux seit jeher beschäftigen, Herkunft, Aufbruch, Rückbesinnung, und für die sie auch damals schon diese so unverwechselbar schnörkellose und unsentimentale Sprache gefunden hatte.
Sie selbst nennt sich eine "Archäologin" in eigener Sache. Und in ihrem Versuch, in der Mutter jene Frau zu fassen zu bekommen, "die außerhalb von mir existiert hat", bewegt sie sich auf der Bruchkante von Familie und Gesellschaft. Der autofiktionale Text "Eine Frau" ist kein Roman, auch keine Biographie, sondern liegt irgendwo zwischen Literatur, Soziologie und Geschichtsschreibung.
Annie Ernaux' Mutter, die 1906 am Rande der normannischen Kleinstadt Yvetot geboren wurde und 1986 in der Geriatrie eines Pariser Vororts gestorben ist, in dem sie an Alzheimer erkrankt die letzten beiden Jahre ihres Lebens verbrachte, entstammte einfachen Verhältnissen. Der Vater war Fuhrmann, die Mutter Weberin, sie war das vierte von sechs Kindern. Mit zwölf Jahren verlässt sie die Schule, um in einer Margarinefabrik zu arbeiten, und fühlt sich als Arbeiterin den Land- und Dienstmädchen überlegen. Ihr größter Traum aber ist es, einen eigenen Laden zu eröffnen. Als sie 1928 heiratet, kann sie, getrieben vom Willen zum gesellschaftlichen Aufstieg, ihren Wunsch endlich verwirklichen.
Die Derbheit ihrer Herkunft wird sie zeit ihres Lebens nicht ablegen, die Armut aber durchaus. Ihren Laden führt sie allein, verhandelt mit Behörden und Lieferanten, bemüht sich, ein fehlerfreies Französisch zu sprechen. Vor allem aber tut sie alles dafür, dass es ihre Tochter Annie, die 1940 geboren wird, einmal besser haben wird als sie. Sie überhäuft das Kind mit Geschenken und Fürsorge, schickt es auf ein teures Pensionat: "Ihr größter Wunsch war es, mir alles zu geben, was sie selbst nicht gehabt hatte."
Als das umsorgte Kind älter wird und schließlich zum Studium nach Paris geht - "jetzt verkaufte sie von morgens bis abends Kartoffeln und Milch, damit ich in einer Vorlesung über Platon sitzen konnte" -, beginnt sich die Tochter ihrer Herkunft zu schämen. Immer ist ihr die Mutter ein bisschen zu laut, zu dick, zu vulgär. Neidvoll blickt Annie auf die kleinbürgerlichen Mütter ihrer Freundinnen, die anders als die eigene Mutter schlank und zurückhaltend waren und kochen konnten.
Scham wird für Annie Ernaux zum prägenden Gefühl jener Jahre, Scham für das Herkunftsmilieu, wie dies auch in den Büchern ihrer Landsleute Edouard Louis oder Didier Eribon manifest wird. Annie Ernaux hat als Kind ihre Mutter zu sehr bewundert, "um ihr jetzt nicht übelzunehmen, dass sie mich nicht unterstützen konnte".
Als die Tochter dann einen Studenten aus Bordeaux heiratet und sich das Paar mit seinen zwei Kindern fern der Normandie, in Annecy, niederlässt, ist sie endgültig angekommen in einer anderen Gesellschaftsschicht. Dort ist man zwar nicht unbedingt vermögend, aber man hat studiert und kann zu jedem Thema etwas Kluges anmerken, die Damen spielen Bridge miteinander. Annie Ernaux gelingt es in "Eine Frau", ihre Mutter gleichermaßen kompromisslos und zärtlich zu beschreiben, entlarvend und mitfühlend. Das lässt die ganze Ambivalenz dieser Mutter-Tochter-Beziehung greifbar werden, die sich im Laufe ihrer beiden Leben immer wieder neu sortiert hat.
Annie Ernaux: "Eine Frau".
Aus dem Französischen von Sonja Finck.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 88 S., geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main