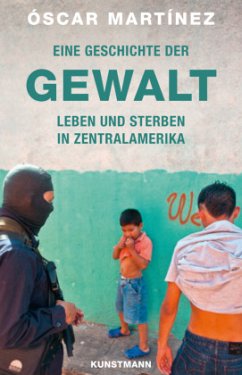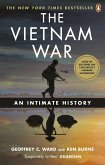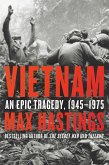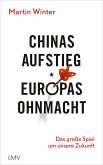Óscar Martínez preisgekrönte Reportagen führen uns direkt in das Chaos Zentralamerikas - in eine Region, in der das Gesetz von Klingen und Kugeln herrscht und aus der die Menschen zu Millionen fliehen.In den Staaten Zentralamerikas herrscht das organisierte Verbrechen. Die strategische Lage hat Länder wie Guatemala, Honduras, El Salvador und Nicaragua zu wichtigen Transitländern des internationalen Drogenhandels gemacht und ihnen die höchsten Mordraten der Welt gebracht. Das staatliche Machtvakuum in diesen Ländern haben längst organisierte Banden wie die Mara Salvatrucha oder Barrio 18 besetzt - hier herrscht das Gesetz von Klingen und Kugeln. Óscar Martínez' preisgekrönte Reportagen führen uns direkt in das Chaos Zentralamerikas - er berichtet von Brunnen, die sich mit Leichen füllen, von Kronzeugen, die der Staat vergessen hat, von jugendlichen Killern, die für einen Beutel Gras töten und von dem profitablen Geschäft der internationalen Kartelle mit Kokain und Migranten. Er schreibt über die Sisyphusarbeit des einzigen Gerichtsmediziners in El Salvador, über die Herren der Grenzen im Dschungel Guatemalas, über mexikanische Bordelle, in denen die zentralamerikanischen Flüchtlinge verkauft werden. Das Bild, das sich aus seinen Reportagen ergibt, ist erschreckend: eine Region, die von Angst und Perspektivlosigkeit beherrscht wird und aus der die Menschen zu Millionen fliehen.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Der Titel für diese Reportagensammlung scheint gut gewählt, liest man Cord Aschenbrenners Rezension. Oscar Martinez hat über Jahre mit Polizisten, Staatsanwälten, Politikern und Kriminellen in Mittelamerika gesprochen und zeichnet ein deprimierendes Bild dieser Gesellschaften: Die Kriminalität ist so ausufernd und brutal, dass sie jedes zivile Leben zu vernichten scheint. Die Politik hat aufgegeben und lässt ihre Bürger ungeschützt, oder ist korrupt und macht mit den Banden gemeinsame Sache, lernt Aschenbrenner. Martinez nennt die Dinge beim Namen, ist genau, ohne den blutigen Schrecken auszumalen, so der Rezensent, den gerade diese nüchterne Darstellungsweise und die Hoffnungslosigkeit, die sie offenbart, erschüttert hat.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Kronzeugen finden auch ihren Killer: Der Journalist und Schriftsteller Óscar Martínez legt eine Bestandsaufnahme krimineller Gewalt in Mittelamerika vor.
Die täglich neuen Schreckensmeldungen über Kriege, Zerstörung, Mord und Gewalt in den arabischen Ländern lassen vergessen, dass in einer ganz anderen Weltregion seit Jahrzehnten Massaker an der Zivilbevölkerung, organisierte Kriminalität und Bandenunwesen alltäglich sind und ganze Länder in einem Teufelskreis aus Gewalt und Gegengewalt, angetrieben von Korruption, Unfähigkeit der Regierungen und reiner Mordlust, zu versinken drohen. In den zentralamerikanischen Ländern Guatemala, El Salvador, Nicaragua und Mexiko haben die Bürgerkriege nicht nur Hunderttausende Menschen das Leben gekostet, sie haben auch neue Formen der Gewalt entstehen lassen. Eines der auffälligsten Phänomene sind die Jugendbanden, die "Maras", die zur Geißel der Region geworden sind. Ihr einziger Zweck besteht darin, Raubzüge zu unternehmen, Vergewaltigungen, Morde und andere Verbrechen zu begehen. Alle Versuche, sie mit harter Hand zu verfolgen oder ihnen auf andere Weise den Garaus zu machen, sind bislang gescheitert.
Über Mittelamerika führt die Hauptroute des in den Andenländern, insbesondere Kolumbien und Peru, produzierten Kokains und anderer Rauschmittel in die Vereinigten Staaten. Das einträgliche Geschäft machen sich Drogenkartelle und Jugendbanden streitig, deren Mitglieder oft selbst drogenabhängig sind. Die Entstehung der Maras als Netzwerk der Gewalt geht auf das Jahr 1992 zurück, als die Polizei in Los Angeles eine Jugendgang aus Hispanics, die "Mara Salvatrucha" (Salva: El Salvador, trucho: gewitzt), als Verursacher eines Aufruhrs ausmachte und deren Mitglieder sowie rivalisierende Mareros aus Mexikanern und Flüchtlingen aus Honduras, Guatemala und Nicaragua festnahm. Auf Beschluss des amerikanischen Kongresses mussten die Inhaftierten später in ihre Heimatländer abgeschoben werden. So kamen zwischen 2000 und 2004 zwanzigtausend kriminelle Jugendliche in die mittelamerikanischen Staaten zurück, wo sie in einem Milieu aus extremer Armut, Arbeitslosigkeit, Analphabetismus, korrupten Regierungen und Sicherheitskräften einen idealen Nährboden für ihr kriminelles Tun fanden.
Über die von Maras wie anderen kriminellen Organisationen in Mittelamerika verübten Verbrechen und deren Opfer gibt es so gut wie keine verlässlichen Angaben. Die Dunkelziffer ist extrem hoch. Vorgebliche Erfolgsberichte von Regierungen sind mit großer Vorsicht zu betrachten, meist sind sie propagandistisch aufgemotzt, in Wahlkampfzeiten sowieso. Kein Präsidentschaftskandidat lässt es an dem Versprechen fehlen, nun mit der Gewaltkriminalität endgültig aufräumen zu wollen. Doch kaum im Amt, kommt heraus, das der Staatschef selbst oder seine Entourage in Korruptionsfälle oder andere Verbrechen verwickelt ist. Der jüngste Fall ist jener des früheren guatemaltekischen Präsidenten Otto Pérez Molina, der wenige Monate vor dem Ende seiner Regierungszeit wegen schwerer Korruptionsvorwürfe zurücktrat und kurz darauf, Anfang September 2015, zusammen mit seiner Vizepräsidentin verhaftet wurde.
Pérez Molina, ein ehemaliger Militiär, dem vorgeworfen wird, in den achtziger Jahren während der Herrschaft des Diktators Efraín Ríos Montt schwere Menschenrechtsverletzungen begangen, gefoltert und Massaker verübt zu haben, hatte versprochen, "mit harter Hand" gegen die organisierte Kriminaliät vorzugehen. Doch er erreichte so gut wie nichts. Zu seinem Nachfolger wurde der konservative Komiker Jimmy Morales gewählt, ein evangelikaler Christ, der selbstverständlich die Korruption zu seinem Hauptgegner erklärt hat, aber wohl eher aus Verdruss der Bevölkerung über die traditionelle Politikerkaste als in der Zuversicht gewählt wurde, er werde das Wunder vollbringen, das Land von der Seuche der organisierten Kriminalität zu befreien. Der salvadorianische Journalist und Schriftsteller Óscar Martínez beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema der Gewalt in Zentralamerika und versucht mit seinen auf einem Internetportal (elfaro.net) veröffentlichten Reportagen Licht in das Dunkel der "Geschichte der Gewalt" zu bringen, wie der Titel seines jetzt auf Deutsch erschienenen Buches verheißt. Martínez hat sich unerschrocken und oft unter Lebensgefahr an die Schauplätze der Gewalttaten begeben, hat mit Opfern, Tätern, Mitwissern, Polizisten und Politikern gesprochen und so in den zahlreichen Episoden ein unglaublich vielfältiges Röntgenbild des Gewaltspektrums in Zentralamerika erstellt.
Ein Beispiel für das unselige Zusammenwirken von schierer Mordlust, Wegsehen oder gar Komplizenschaft der Behörden und einer nicht minder zahnlosen Justiz ist etwa der Fall von Miguel Ángel Tobar, dem Anführer einer Gang, der laut eigener Aussage sechsundfünfzig Menschenleben auf dem Gewissen hatte, unter anderem, um einen seiner ermordeten Brüder zu rächen. Er war zugleich wertvoller Mitarbeiter der Polizei, die dank seiner Hilfe als "Kronzeuge" mehr als dreißig Mitglieder anderer Gangs zur Strecke brachte. Der salvadorianische Staat sagte ihm Schutz zu, stellte ihm ein Häuschen und schickte jeden Monat einen Korb mit Lebensmitteln. Doch bei der Polizei war er verhasst, weil er auch gegen zwei der Sicherheitsleute aussagte. Sie schleust ihn in eine Bande ein, damit er über deren Taten berichten kann. Er wird verfolgt, festgenommen, freigelassen und schließlich, am 21. November 2014, ermordet - fünfzig Meter von der Polizeidienststelle entfernt.
In seinem Buch hat Óscar Martínez seine Reportagen nicht nur aneinandergereiht, um sie bequem als Sammelband zu publizieren, sondern sie zu einer lebendigen Geschichte miteinander verschmolzen und darüber hinaus versucht, aus den einzelnen Begebnissen Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Vereinigten Staaten hätten während der Bürgerkriege von den Sechzigern bis in die neunziger Jahre Diktaturen in Mittelamerika unterstützt und damit, ebenso wie die Guerrilla, zur Verbreitung der Gewalt beigetragen. Später habe sich Washington lediglich darauf konzentriert, die Auslieferung der Bandenbosse zu erzwingen, sich aber nicht um die unter der Gewalt leidende Zivilbevölkerung gekümmert, lautet eine der Thesen in Martínez' Buch. In den mittelamerikanischen Ländern sei dann der "Bodensatz" übrig geblieben, zitiert er einen seiner durchaus glaubwürdigen Gesprächspartner. Dies habe dazu geführt, dass aus dem Dutzend früherer Verbrecherbanden mehr als fünfzig kleinere, teilweise noch gefährlichere Gangs entstanden sind. Aus den früheren Kriminellen, die noch strategisch vorgegangen waren, seien primitive Killer geworden.
Die Abwesenheit und Hilflosigkeit des Staates, die Korruptionsanfälligkeit der Staatsdiener, die Schutzlosigkeit von Kronzeugen und die Brutalität der Drogenbanden hätten eine Situation entstehen lassen, aus der es kaum ein Entrinnen zu geben scheint. Für Leser des Buchs, die mit der politischen und gesellschaftlichen Situation in Zentralamerika weniger vertraut sind, ist es nicht ganz einfach, die zahllosen Fakten, Schauplätze und Begebenheiten einzuordnen. Das Gesamtbild, das sich bei der Lektüre ergibt, lässt aber erahnen, in welchem Zustand Bürgerkriege Länder und Regionen nach Friedensschlüssen hinterlassen, wenn sich nicht auf allen Seiten der Wille zur Überwindung der Gewalt durchsetzt. Angesichts der gegenwärtig auf dieser Welt ausgetragenen Konflikte sind das keine guten Vorzeichen.
JOSEF OEHRLEIN
Óscar Martínez: "Eine Geschichte der Gewalt". Leben und Sterben in Zentralamerika. Aus dem Spanischen von Hans-Joachim Hartstein. Antje Kunstmann Verlag, München 2016. 300 S., geb., 24,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main