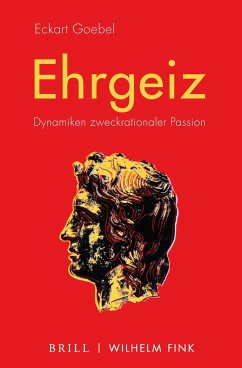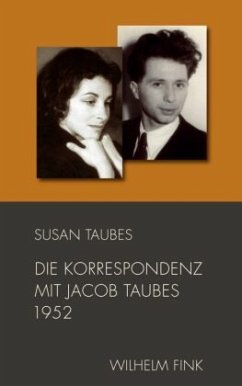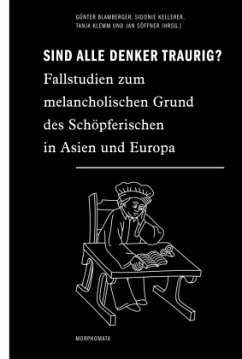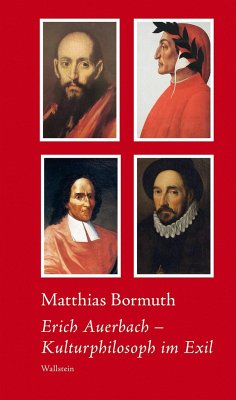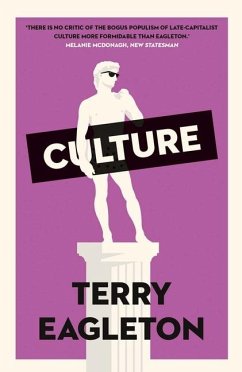Eine Kulturgeschichte der Kulturwissenschaft
2. Auflage
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
56,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Um der Kulturwissenschaft das Verenden im Kulturmanagement zu ersparen, hilft nur ein Rückgang zur eigenen Geschichte. Mit kulturwissenschaftlicher, also nicht ideengeschichtlicher Methode versuchen fünf Kapitel, den zweihundertjährigen Weg von Giambattista Vico wenigstens bis Martin Heidegger nachzugehen. Das heißt auch, die Gründerhelden der Kulturwissenschaft kulturhistorisch zu verorten: als Professoren, Beamte, Kolonisten usw. Das erste Kapitel rekonstruiert, wie Vico die Kulturwissenschaft in Frontstellung gegen die cartesische Mathematik der Natur gründete und schon darum bis Herd...
Um der Kulturwissenschaft das Verenden im Kulturmanagement zu ersparen, hilft nur ein Rückgang zur eigenen Geschichte. Mit kulturwissenschaftlicher, also nicht ideengeschichtlicher Methode versuchen fünf Kapitel, den zweihundertjährigen Weg von Giambattista Vico wenigstens bis Martin Heidegger nachzugehen. Das heißt auch, die Gründerhelden der Kulturwissenschaft kulturhistorisch zu verorten: als Professoren, Beamte, Kolonisten usw.
Das erste Kapitel rekonstruiert, wie Vico die Kulturwissenschaft in Frontstellung gegen die cartesische Mathematik der Natur gründete und schon darum bis Herder, Volney und Hegel auf Geschichtsphilosophie festlegte. Das zweite stellt Schriftsteller wie Flaubert und Kulturwissenschaftler wie Victor Hehn vor, die aus den undenkbaren Resten des Deutschen Idealismus unseren Begriff von Alltagskultur gewonnen haben. Das dritte Kapitel über Nietzsche behandelt die Tragödie eines Denkens, das diese kulturwissenschaftliche Historisierung aller Grundbegriffe zunächst wieder in Philosophie, zuletzt aber in große Politik umzumünzen suchte. Die letzten zwei Kapitel schließlich sind den Folgen gewidmet, die diese Tragödie noch im zwanzigsten Jahrhundert gezeitigt hat. Freuds Psychoanalyse und Frazers Ethnologie stehen dabei für Unternehmen, Nietzsches Traum und Nietzsches Rausch in empirische Kulturwissenschaften zu überführen, Heideggers Denken für das umgekehrte Unternehmen, die große Kulturpolitik als Gigantomachie des Seins selber zu vollenden.
Heute glauben wir dagegen zu wissen, daß Kulturen sind, ohne grundlose Gründe zu haben. Das hat dieses Buch möglich, aber auch unvollständig gemacht. Kulturwissenschaften unter Bedingungen von Technologie und Mathematik, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich und Amerika entstanden sind, bleiben einer möglichen Fortsetzung vorbehalten.
Das erste Kapitel rekonstruiert, wie Vico die Kulturwissenschaft in Frontstellung gegen die cartesische Mathematik der Natur gründete und schon darum bis Herder, Volney und Hegel auf Geschichtsphilosophie festlegte. Das zweite stellt Schriftsteller wie Flaubert und Kulturwissenschaftler wie Victor Hehn vor, die aus den undenkbaren Resten des Deutschen Idealismus unseren Begriff von Alltagskultur gewonnen haben. Das dritte Kapitel über Nietzsche behandelt die Tragödie eines Denkens, das diese kulturwissenschaftliche Historisierung aller Grundbegriffe zunächst wieder in Philosophie, zuletzt aber in große Politik umzumünzen suchte. Die letzten zwei Kapitel schließlich sind den Folgen gewidmet, die diese Tragödie noch im zwanzigsten Jahrhundert gezeitigt hat. Freuds Psychoanalyse und Frazers Ethnologie stehen dabei für Unternehmen, Nietzsches Traum und Nietzsches Rausch in empirische Kulturwissenschaften zu überführen, Heideggers Denken für das umgekehrte Unternehmen, die große Kulturpolitik als Gigantomachie des Seins selber zu vollenden.
Heute glauben wir dagegen zu wissen, daß Kulturen sind, ohne grundlose Gründe zu haben. Das hat dieses Buch möglich, aber auch unvollständig gemacht. Kulturwissenschaften unter Bedingungen von Technologie und Mathematik, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich und Amerika entstanden sind, bleiben einer möglichen Fortsetzung vorbehalten.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.