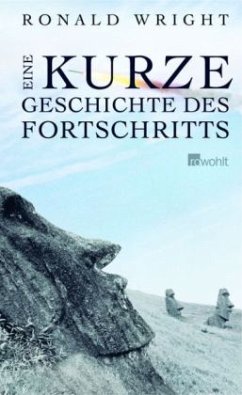Warum der Mensch vom Aussterben bedroht ist.
Selbst im Verhältnis zur Geschichte seiner eigenen Existenz auf Erden ist die Geschichte des menschlichen Fortschritts kurz. Und sie könnte schon bald zu Ende sein. Wie gingen Aufstieg und Fall bedeutender Zivilisationen vorsich, was können, ja müssen wir daraus lernen? Ronald Wright gibt in seinem ebenso kurzweiligen wie nachdenklichen Durchgang durch unsere Gattungsgeschichte Antworten auf diese Fragen. "Der große Vorteil, den wir haben, unsere beste Chance, ist unser Wissen um die vergangenen Gesellschaften. Wir können sehen, wie und warum sie gescheitert sind. Homo sapiens hat die Informationen, sich selbst als das zu erkennen, was er ist: ein eiszeitlicher Jäger, stehen geblieben auf halbem Weg zur Intelligenz, gescheit, aber nur selten weise." (Ronald Wright )
Selbst im Verhältnis zur Geschichte seiner eigenen Existenz auf Erden ist die Geschichte des menschlichen Fortschritts kurz. Und sie könnte schon bald zu Ende sein. Wie gingen Aufstieg und Fall bedeutender Zivilisationen vorsich, was können, ja müssen wir daraus lernen? Ronald Wright gibt in seinem ebenso kurzweiligen wie nachdenklichen Durchgang durch unsere Gattungsgeschichte Antworten auf diese Fragen. "Der große Vorteil, den wir haben, unsere beste Chance, ist unser Wissen um die vergangenen Gesellschaften. Wir können sehen, wie und warum sie gescheitert sind. Homo sapiens hat die Informationen, sich selbst als das zu erkennen, was er ist: ein eiszeitlicher Jäger, stehen geblieben auf halbem Weg zur Intelligenz, gescheit, aber nur selten weise." (Ronald Wright )
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Erschrocken reagiert der Rezensent auf die Erkenntnis, die in diesem "spannenden" Buch lauert: Der Mensch ist dumm und hat auch in tausend Jahren nichts dazugelernt. Martin Urban folgt dem britischen Archäologen Ronald Wright durch "Eine kurze Geschichte des Fortschritts", die offenbar wenig mit Fortschreiten, dafür umso mehr mit beharrlicher Fehlbarkeit zu tun hat. Von den immer hungrigen Jägern der Altsteinzeit bis ins ressourcenknappe Heute reicht die Message, die Urban dem Band entnimmt: "Rotte deinen Wirt nicht aus." Ein ernstzunehmender Aufruf, findet Urban, nicht zuletzt weil Wissenschaftspublizisten wie Wright "besser als Spezialisten die Welt deuten können".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Marburg, circa 1972: Eine Dame, an deren Aussehen ich mich nicht mehr erinnere, überreicht mir auf der Straße ein frommes Traktat: "Lesen Sie das, es könnte Sie retten!" Ich habe es gelesen. Gerettet hat es mich wohl eher nicht. Aber wenn die Ewigkeit in Gefahr ist, sollte man lieber zuviel als zuwenig lesen. In "Eine kurze Geschichte des Fortschritts" geht es Ronald Wright auch um die Rettung der Welt ("Eine kurze Geschichte des Fortschritts". Deutsch von Monika Niehaus-Osterloh. Rowohlt Verlag, Reinbek 2006. 203 S., geb., 16,90 [Euro]). Er fängt ruhig und sachlich an. Man merkt es aber hinterher, er hat sich zurückgehalten, weil er uns Leser nicht verschrecken wollte. Am Ende sagt er es deutlich: "Wir haben jetzt die letzte Chance, unsere Zukunft in die richtigen Bahnen zu lenken." Ob das berechtigte Panik oder Paranoia ist, werden vielleicht unsere Urenkel wissen. Man sollte zumindest genau zuhören, wenn Kassandra spricht.
Ronald Wrights Theorie ist . . ., nun ja, er hat gar keine Theorie. Jedenfalls keine vollständige. Genau das macht den Reiz des Buches aus. Ronald Wright ist wie Agatha Christies Romanfigur Miss Marple. Er denkt in skalierten Analogien. Der Bankdirektor, der die Smaragde eskamotiert, gleicht dem Gärtner, der den Portwein stiehlt. In beiden manifestieren sich menschliche Eigenschaften und Gewohnheiten. Wright war ursprünglich Archäologe. Im Buch führt er uns alte Zivilisationen vor und zeigt Parallelen zur Gegenwart auf. Es liegt schließlich nahe, daß die Gespenster der Vergangenheit weiter spuken werden. Ein ähnliches Thema hat das im englischen Original etwas später erschienene Buch "Kollaps" von Jared Diamond (F.A.Z. vom 19. Oktober 2005).
Für über fünfzehntausend Jahre hatten die Alte Welt und die Neue Welt so gut wie keinen Kontakt. Das steigende Meer trennte sie am Ende der letzten Eiszeit. Erst nach dieser Sezession wurde die Landwirtschaft erfunden - zweimal. Erste Zivilisationen entstanden. Wright spricht von zwei "kulturellen Experimenten" in unabhängigen "sozialen Laboratorien". In beiden Labors wuchsen und zerfielen komplexe Reiche, und die Ergebnisse der Experimente ähnelten sich frappant. Das Wesen der Zivilisation ist also im vorzivilisierten Menschen schon angelegt wie der Falter in der Raupe. Es sind Gesetze, die wohl auch für unsere heutige globale Zivilisation gelten. Diese Gesetze gilt es zu ergründen.
Zwei Beispiele sind das Reich der Römer und das der Mayas. Beide waren, was Wright ein Pyramidenmodell nennt. Gemeint ist damit ein Schneeballsystem. Nur ein permanentes Wachstum ermöglichte den stetigen Fortbestand des Gemeinwesens, bis dann irgendwann die Grenze überschritten wurde und es zum Zusammenbruch kam. Dieser Kollaps war in beiden Fällen nicht vollständig. Italien hat sich vielleicht seit 378 nicht mehr richtig aufgerappelt, aber beim Olivenöl und beim Wagenrennen ist es immer noch in der Spitzengruppe. Auch die Mayas haben überlebt. Acht Millionen sprechen heute die Maya-Sprachen, etwa so viele wie während der Blütezeit des Reichs. Der Regenwald hat die präkolumbischen Maisfelder zurückerobert. In Nordafrika wurde uralter Kulturboden von den Römern endgültig zerstört. Geraubt, geplündert, durch Kriege und Naturkatastrophen vernichtet!
Bei zwei weiteren Beispielen bleibt uns nicht einmal der Trost, es hätte schlimmer ausgehen können. Hier kam es zum größten anzunehmenden Unfall. Die Osterinsel war ein angenehmes Eiland, als die polynesischen Siedler dort ankamen. Innerhalb eines Jahrtausends zerstörten sie dann die Wälder. Kein Baum überlebte. Es gab kein Holz mehr, also auch kein Haus, kein Boot, keine Zivilisation. (Wenn Sie das an unseren Umgang mit dem Erdöl erinnert, dann haben Sie vielleicht recht.) Der Niedergang wurde durch religiösen Wahn beschleunigt. Die steinernen Götzen hatten ihren Preis. Auch als das Verderben schon abzusehen war, änderten die Bewohner ihr Verhalten nicht, denn sie hofften auf übernatürliche Hilfe.
Der andere GAU war der Untergang des Reichs Sumer. Im Süden des heutigen Iraks entstand um 3000 vor Christus die allererste Zivilisation. Sümpfe wurden trockengelegt und Kanäle gegraben. Hier wurden die Stadt, das Unternehmertum, die Schrift, das Berufssoldatentum und die Erbmonarchie erstmalig ausprobiert. Doch nach tausend Jahren war Schluß. Durch die künstliche Bewässerung war der Boden so versalzen, daß er sich bis heute nicht mehr erholt hat. Ein Grund für die Katastrophe war das Bevölkerungswachstum, das es verhinderte, dem Ackerland Zeit zur Regeneration zu geben.
Die ägyptische und die chinesische Zivilisation erwiesen sich als dauerhafter. Die alljährliche Überschwemmung des Nils mit fruchtbarem Schlamm war ein Automatismus, bei dem wir Menschen nicht viel zerstören konnten. Und in China ist der Lößboden tief und verzeiht deshalb fast jeden Anbaufehler. Manchmal ist die Natur so robust, daß sie uns verkraftet.
Das ist in etwa das, was Ronald Wright uns vorführt. Er zeigt uns, was beim Umgang mit der Natur schiefgehen kann und womöglich zum wiederholten Male schiefgehen wird. Patentrezepte besitzt er keine. Das Buch ist schmal, aber gehaltvoll, Lektüre für einen verregneten Sonntag. Danach kann man noch ein paar Jahre lang nachdenken. Lesen Sie das! Es könnte Sie retten.
ERNST HORST
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main