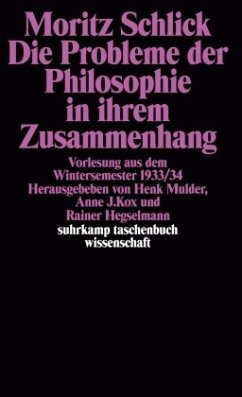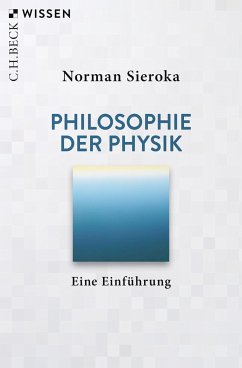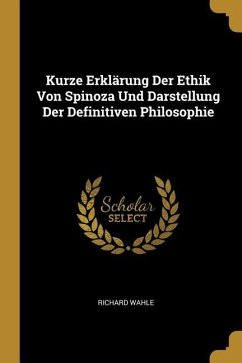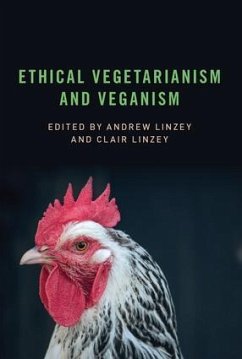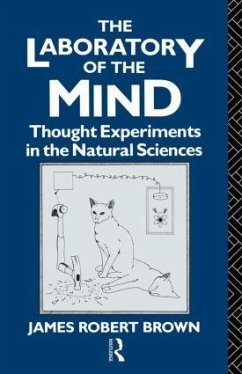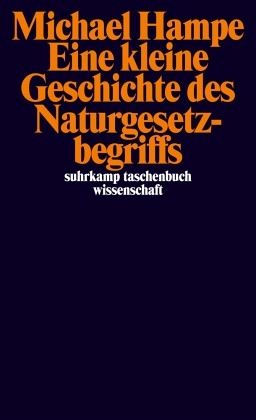
Eine kurze Geschichte des Naturgesetzbegriffs
Die Gesetze der Natur und die Handlungen des Menschen
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
14,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Von Determinismus und Freiheit war in den letzten Jahren viel die Rede. In Auseinandersetzung mit der Hirnforschung mußte vor allem die Philosophie häufig an differenzierte Auffassungen zu menschlicher Freiheit erinnern, die das abendländische Denken hervorgebracht hat. Gleiches ist für die vermeintlich determinierten Ereignisse in der Natur zu leisten. Denn was es bedeuten soll, daß in der Natur alles festgelegt ist, versteht nur, wer sich vor Augen führt, wie Naturgesetzlichkeit in der Entwicklung von Philosophie und Wissenschaft begriffen wurde.Michael Hampe hat eine kurze Geschichte des Naturgesetzbegriffs von der Antike bis zur Gegenwart geschrieben. Sie zeigt, daß es nie nur ein einziges einheitliches und "reines" Verständnis der Naturnotwendigkeiten gegeben hat, sondern immer auch theologische, juristische und moralische Ideen unser Naturverständnis geprägt haben und bis heute bestimmen.