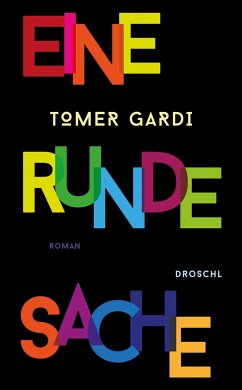In "Eine runde Sache" reisen zwei Künstler aus zwei unterschiedlichen Jahrhunderten durch sprachliche und kulturelle Räume und sind immerzu in Bewegung. Fremdheitserfahrungen, Identität, das Leben als Künstler und jede Menge Politik sind die großen Themen des Romans, in dem sich die beiden Handlungsstränge gegenseitig spiegeln.Zuerst schickt sich Tomer Gardi selbst, auf Deutsch verfasst, als literarische Figur mit dem sprechenden Deutschen Schäferhund Rex und dem Elfen- oder gar Erlkönig an seiner Seite auf eine fantastisch-abenteuerliche Odyssee. Slapstickartig, komisch und mit vielen unterschwelligen Nadelstichen peitscht der Wind in die Segel. Im zweiten Teil des Romans, übersetzt aus dem Hebräischen, folgen wir dem im 19. Jahrhundert lebenden indonesischen Maler Raden Saleh von Java durch Europa und zurück nach Asien - ein historischer Roman und zugleich ein Abbild unserer Zeit.Virtuos spielt Tomer Gardi mit Sprachen. Mit all seiner Originalität und dem Überbordwerfen konventioneller Romankonzeptionen löst er auch die Krux mit der Wahl der Sprache, die sein literarisches Ich martert. Sagt es zu Beginn des Romans doch, »dass ich ein Idee für eine Geschichte habe, weiß aber nicht, ob ich es auf Hebräisch schreiben soll, oder auf meinem Deutsch. (...) Jeder Stimme wird ja was anderes und unterschiedliches Ausdrücken können. Andere und unterschiedliche Fantasien entwickeln, von andere und unterschiedliche Lebenserfahrungen erzählen können. (...) Und wie kann ich entscheiden?«
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Oliver Jungen unterhält sich fabelhaft mit Tomer Gardis spiegelbildlichen Erzählungen, die der Autor zu einem Roman über Identität zusammenfasst. Wie der Autor den Mythos vom Ewigen Juden und die Geschichte des indonesischen Malerfürsten Raden Saleh in den beiden Texte zu einem Antimärchen über die "Heimatsuche von Künstlernaturen" verklebt, findet Jungen so überbordend witzig wie fordernd, da der Autor allerhand Urdeutsches vom Schäferhund bis zum Erlkönig auftreten lässt und alles in seiner Kunstsprache beschreibt und bisweilen in einem "Schäferhund-Deutsch".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Gewundene Wege, romantischer Blick, freche Schnauze: Tomer Gardis doppelter Identitätsroman bringt einen erfrischenden Ton in den Zugehörigkeitsdiskurs.
Eine Sache kann schief sein und doch rund wirken. Das Portugiesische hat mit "barocco" sogar ein Wort für schiefrunde Perlen, deren Reiz gerade darin besteht, keine vollendete Kugel zu sein. In diesem Sinne ließe sich auch das Buch des in Berlin lebenden israelischen Schriftstellers Tomer Gardi als "runde Sache" ansehen. So verschieden die beiden darin enthaltenen, in sich wiederum kreisförmig angelegten Erzählungen auf allen Ebenen sind, wirken sie doch wie verzerrte Spiegelbilder voneinander. Hier wie dort nämlich geht es um eine endlose Identitätssuche von Künstlernaturen, und insbesondere ein Motiv ist es, das dieses kuriose Prosa-Paar zur Perle rundet: das des Ewigen Juden.
Gardi fasst den alten Mythos unter Anlehnung an den französischen Feuilletonliteraten Eugène Sue als ewige Strafwanderschaft auf und parallelisiert ihn der Sage des Fliegenden Holländers. Der gleichnamige Propagandafilm der Nationalsozialisten schwingt allenfalls als Assoziation mit, aber der Grund für das ziellose Irren liegt unschwer erkennbar in einem rassistischen Absprechen der Zugehörigkeit, mal ganz direkt, mal romantisch verbrämt.
Die erste der beiden Geschichten ist eine fulminant grobianische Groteske mit so viel Witz, Feuer und Skurrilität, als würde Helge Schneider eine Satire von Scholem Alejchem nachzuerzählen versuchen. Als Icherzähler fungiert ein gewisser Tomer Gardi, ein "gieriger Mensch" und daher stets der Erste am Buffet, wobei ihm am Eröffnungsabend eines Theaterfestivals ein Missgeschick passiert - "ein Stück Salzgürke" flutscht ihm vom Teller, auf dem ausgerechnet der Intendant ausrutscht und "auf seiner Arsch" landet: "Das Leben hat die Kunst beleidigt" - was sich nur durch eine "passende Erklärung", also eine Geschichte, wiedergutmachen lässt. Als ebendie präsentiert sich das freihändig erdachte Antimärchen aus deutschen Wäldern. Einen guten Teil seines enormen Sprachwitzes verdankt es dem dabei verwendeten Gardi-Deutsch, einer von diesem Autor zur Perfektion gebrachten Kunstsprache, deren Reiz gerade darin besteht, kein vollendetes Duden-Idiom zu sein. Dass Gardis "Broken German", das beim Ingeborg-Bachmann-Preis vor einigen Jahren eher konsterniert zur Kenntnis genommen wurde, nicht nur effektvoll lakonisch ist, sondern melodisch und rhythmisch hochgradig durchgeformt, zeigt sich auf Anhieb an Formulierungen wie: "Der Fluss flieste jetzt ruhig und klar. Eine Idylle, ironisiert. Immer eine Frage der Perspektive, die Idylle."
Auch inhaltlich geht es viel um Aussprache und Missverstehen, denn nur so gelangt der sich nach einer "Yacht" sehnende Protagonist auf eine wilde, deutsche "Jagd" (und zwar als Gejagter). Mit diesem Halali stehen zahlreiche urdeutsche Figuren in Verbindung, darunter ein dauerreimender "Erlkönig" und ein sprechender Schäferhund, der aus kompliziert zu erklärenden Gründen eine Gummi-Automatenvagina als Maulkorb trägt und deshalb nur umlautgebrochenes Schäferhund-Deutsch herausbekommt ("Üch brüngü düch üm"). Das immer abstruser werdende Abenteuer, in dessen Verlauf das Gespann aus Hund, Erlkönig und Ewigem Juden - als solcher erscheint der auf der Flucht Verlotternde den anderen bald - lustig plaudernd einen allegorischen Ort (Bad Obdach) erreicht und dort eine adlerbewachte deutsche Arche zu besteigen versucht, was angesichts der hereinbrechenden Sintflut keine schlechte Idee ist, besteht also aus wüst und komisch ineinander verkeilten Versatzstücken der jüdisch-deutschen Kulturgeschichte, eine Antiidylle, ironisiert.
Die scheiternde Assimilation des Helden (Tomer schlüpft in den gehäuteten Erlkönig, wird aber gleich an seiner Sprache enttarnt) ist dabei ebenso Thema wie seine Weigerung, weiter als "ewiger Zeuge", nämlich "Von dem Kreuz zum gehakten Kreuz", herhalten zu wollen: "Ich bin jetzt in Fantasie interessiert." Wie Ahab am Wal endet dieser frechzüngige Ahasver an der Außenseite der durch die Zeiten geworfenen Arche. Und tatsächlich gelingt es dem Autor, diese um ein Haar im Mythos ertrunkene, dabei bis zuletzt krachlustige Erzählung samt abschließendem Clou (einem Identitäts-Rollentausch, einer Verneigung vor dem Theater) in die Rahmenhandlung zurückzuschleudern.
Klassisch erzählt hingegen mutet die von Anne Birkenhauer aus dem Hebräischen übersetzte, auf den ersten Blick rein historisch-biographische Spiegelerzählung an, die freilich ebenfalls einen Ausfall ins Zotige enthält. Zudem gibt es wieder eine eigenwillige Rahmenhandlung, die die Erzählsituation begründet. Demnach ist es ein Museumswächter des Dresdner Albertinums, der die (detailliert recherchierte) Lebensgeschichte des Malers Raden Saleh zum Besten gibt, und zwar leicht barock überbordend und samt erdachtem Gerücht über ein obszönes Porträt, das der javanische Prinz von seinem Mentor Jean Baud, Generalgouverneur von Niederländisch-Ostindien, angefertigt haben soll. Saleh, Gründer der modernen indonesischen Malerei, der Jahrzehnte in Europa verbrachte, bietet sich als Held geradezu an, weil an diesem Grenzgänger Stereotype zu zerbrechen scheinen: ein dunkelhäutiger Mann aus den Kolonien, der weiße Bedienstete hatte und in den europäischen Adelshäusern ein und aus ging. Und doch war er nie Gleicher unter Gleichen, in keiner der Kulturen.
Saleh imitierte alle Stile, malte Porträts, Landschaften, Jagd- und Schiffsszenen in teils romantischer, teils orientalistischer Weise. Von Stadt zu Stadt, von Hof zu Hof zieht der Autor mit seinem Helden, zeigt im Detail, wie Saleh nicht ohne Erfolg um Anerkennung kämpfte, aber ein ewig Wandernder blieb. Sein Weg war auch eine Flucht vor der wie ein Fatum über ihm schwebenden Verpflichtung, als königlich niederländischer Hofmaler in seine alte, von den Kolonialherren versklavte Heimat zurückzukehren, um diese für die neuen Machthaber zu porträtieren. Es geschah gleichwohl. In der Kolonie aber galten die klingenden Titel Salehs nichts. Hier herrschte der nackte Rassismus vor, nicht der kultivierte aus den europäischen Salons, und auch Saleh versank nun endgültig zwischen den Identitäten.
Wie sich diese beiden sprachlich, stilistisch und inhaltlich grundverschiedenen Versionen derselben unerfüllten, aber nie larmoyanten, sondern wundersam couragierten Heimatsuche gegenseitig ausbalancieren und damit auf einer Metaebene (der Zweisprachigkeit) selbst kommentieren, ist nicht nur subtil klug, sondern auch fabelhaft unterhaltsam und selten optimistisch. Die Odyssee selbst ist schließlich schon die halbe Ankunft: Tomer Gardi feiert den Irrweg und das Missverstehen, denn auch so, ja: nur so geht es voran. Immer eine Frage der Perspektive, die Idylle. OLIVER JUNGEN
Tomer Gardi: "Eine runde Sache". Roman.
Zur Hälfte aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer. Literaturverlag Droschl, Graz 2021. 256 S., geb., 22,- Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Es ist sooo guuut geschrieben! ... Ich kannte den Autor vorher nicht und nun muss ich sagen: Ich bin jetzt Tomer Gardi Fan!« (Ijoma Mangold) »Ein überaus kunstfertiger Autor!« (Denis Scheck) »Ein vor Assoziationslust sprühendes Buch - und nicht zuletzt auch ausgesprochen unterhaltsam.«(Ulrich Noller, Deutschlandfunk) »Ein Buch, das unfassbar großes Vergnügen bereitet. Und viel Stoff zum Nachdenken.« (Bernd Melichar, Kleine Zeitung) »Ich habe wirklich einen ganz großen Spaß daran gehabt. Gardi macht sich auf eine ungeheuer freie Art über alles Deutsche lustig ... verdammt gut gemacht.« (Sieglinde Geisel, SRF) »Tomer Gardi - ein Schriftsteller zwischen den Welten, der auch seine Figuren losschickt, auf die Suche nach einem Platz in der Welt. Was so leichtfüßig scheint, ist genial gestrickt. Ein sprudelnder, atemloser Roman, der die großen Fragen nach Identität und Heimat verhandelt.« (Juliane Bergmann)