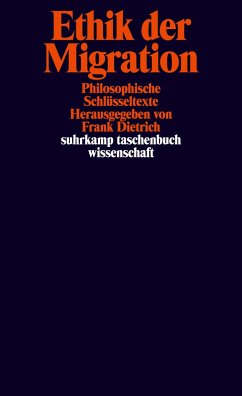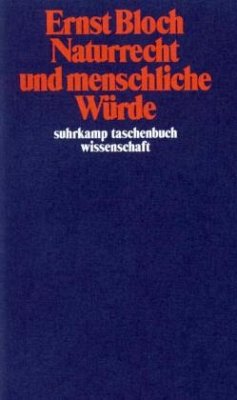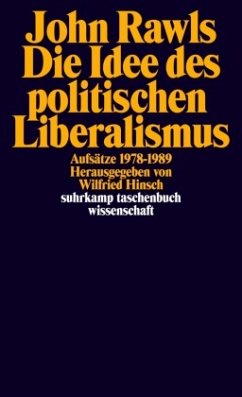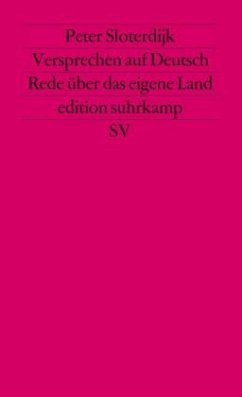Eine Theorie der globalen Verantwortung
Was wir Menschen in extremer Armut schulden

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts lebt ein großer Teil der Menschheit in bitterer Armut. Daraus ergibt sich die brennende Frage, was die Bürger wohlhabender Länder extrem armen Menschen moralisch schulden. Valentin Beck beantwortet sie im Rahmen einer umfassenden Theorie der globalen Verantwortung. In seinem glänzend geschriebenen Buch behandelt er zentrale Fragen der Theorie globaler Gerechtigkeit, unterzieht unsere Verflechtung in globale soziale Strukturen einer detaillierten Analyse und wirft so ein neues Licht auf eine der größten moralischen Herausforderungen unserer Zeit. Wir m�...
Auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts lebt ein großer Teil der Menschheit in bitterer Armut. Daraus ergibt sich die brennende Frage, was die Bürger wohlhabender Länder extrem armen Menschen moralisch schulden. Valentin Beck beantwortet sie im Rahmen einer umfassenden Theorie der globalen Verantwortung. In seinem glänzend geschriebenen Buch behandelt er zentrale Fragen der Theorie globaler Gerechtigkeit, unterzieht unsere Verflechtung in globale soziale Strukturen einer detaillierten Analyse und wirft so ein neues Licht auf eine der größten moralischen Herausforderungen unserer Zeit. Wir müssen mit Blick auf den politischen und individuellen Umgang mit der Weltarmut umdenken, so lautet die zentrale Forderung dieser Studie.