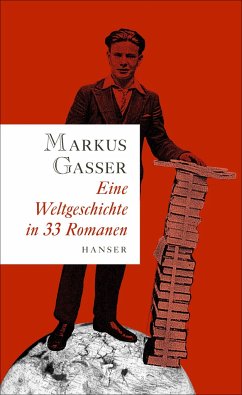Der Schriftsteller und der Historiker sind Wahlverwandte. Beide wollen ihr Publikum fesseln, ob sie erdachte Geschichten erzählen oder packende Tatsachen. Den Schriftstellern liefert die Vergangenheit spannenden Stoff zur Genüge. Markus Gasser präsentiert nun 33 Romane, die zusammen eine Weltgeschichte vom Alten Ägypten bis in unsere Gegenwart ergeben. Thomas Mann, Umberto Eco, Leo Tolstoi, Stefan Zweig und Orhan Pamuk: Sie und viele andere erzählen mit ganz unterschiedlichen Stimmen aus unterschiedlichen Zeiten. Markus Gasser schickt uns auf eine Entdeckungsreise durch die Epochen der Welt- und Literaturgeschichte: Ein verblüffendes literarisches Spiel, ein großes Lektürevergnügen.

Was Markus Gasser in 33 Romanen mit der Vergangenheit anfängt, taucht weder die Geschichte noch die Literatur in ein günstiges Licht.
Von Hans Ulrich Gumbrecht
Markus Gasser ist Privatdozent für Literaturwissenschaft in Innsbruck, lebt in Zürich und hat gerade bei Hanser "Eine Weltgeschichte in 33 Romanen" veröffentlicht. Bereits der Titel lacht allen angestrengten Kriterien des guten intellektuellen Geschmacks so offen ins Gesicht, dass er, zusammen mit dem Prestige des Verlags, zunächst auf eine vielleicht ironische oder überraschende, jedenfalls neue Modalität im Umgang mit literarischen Texten der Vergangenheit hoffen lässt. Eine solche Lektüreform müsste implizit Antworten auf die Frage geben, wie es denn nach langen Jahren der Skepsis heute noch oder wieder möglich und überzeugend sein kann, eine ernstzunehmende "Weltgeschichte" aus der Matrix von fiktionalen Texten zu entwickeln. Literarische "Schriftsteller treten als Wahlverwandte der Historiker" auf, liest man im Ankündigungstext, und "beschwören die Vergangenheit so lebendig herauf, dass der Leser glaubt, er wäre mittendrin". Nicht um eine kritische oder gar erbauliche Form der Geschichtsschreibung scheint es also zu gehen, sondern um die in einigen Debatten der vergangenen Jahre tendenziell rehabilitierte Unmittelbarkeit beim Erleben vergangener Welten.
Das Inhaltsverzeichnis zu Gassers Buch bestätigt diese Vermutung in wenigstens einer Hinsicht, indem es etwas heftig geistreiche Haupttitel (zum Beispiel für das dritte Kapitel, "worin der Leser ganze Schiffsladungen von Schimpfwörtern ertragen muss"), mit Autorennamen und Titeln berühmter Erzählungen ("Homer: Ilias") und - vor allem - präzisen, also Unmittelbarkeit suggerierenden räumlichen und zeitlichen Referenzen kombiniert ("Troja, Westküste Anatoliens, 1250 v. Chr."). Ist "Homer" denn nicht eine Autor-Fiktion, denkt der Leser sofort, und war Troja wirklich eine räumlich und chronologisch so genau zu bestimmende Stadt? Um dann auch zu entdecken, dass Gassers Text-Corpus immerhin den westlichen Literatur-Kanon entschieden überschreitet, ohne eine markante Präferenz für bestimmte Epochen oder gar eine übergreifende These sichtbar werden zu lassen. Allein das an Evelyn Waughs Roman "Wiedersehen mit Brideshead" gebundene erste Kapitel schert aus der zeitlichen Progression dieser "Weltgeschichte" aus, weil es wohl als programmatische Einleitung dienen soll.
Hier entdeckt man dann, dass literarische Texte selbst keineswegs im Zentrum von Gassers Buchs stehen. Vielmehr benutzt er Details aus Waughs Biographie zusammen mit vage evozierten Motiven seines Romans, um eigene Vorstellungen von der Endphase des Zweiten Weltkriegs und - in diesem Fall - auch seine Auffassung über das Verhältnis von Literatur und Geschichte zu beschreiben. Diese Auffassung aber ist banal und lässt, was den Stil angeht, vermuten (oder hoffen), dass ihre Sätze nie unter das kritische Auge eines Verlagslektors gelangt waren: "Man glaubt, man hätte nur ein Leben; dann öffnet man ein Buch, tritt ein, hängt ein Schild vor die Tür, ,Bitte nicht stören, bin auf Zeitreise' - und schon hat es einen mitten hineinverschlagen in die fernsten Epochen, als gehörten sie unserer privaten Erinnerung an. Wir sind, so heißt es, die Geschichten, die wir von uns erzählen können; mit jedem Buch wächst uns eine neue zu, und nur die Kürze unseres Daseins verhindert, dass wir die gesamte Menschheit ins uns versammeln."
Dass "Geschichten, die wir über uns selbst erzählen können", kategorial verschieden sind von denen, die "uns mit jedem Buch zuwachsen", scheint Gasser übersehen zu haben, so wie ihm auch der Unterschied zwischen Texten, welche weltgeschichtlich die Zeit ihrer eigenen Entstehung repräsentieren sollen, und den auf die Vergangenheit zurückgewendeten historischen Romanen keiner Rede wert ist. Das Thomas Manns "Joseph und seine Brüder" gewidmete zweite Kapitel wird - wiederum eigenartig genau - auf "1350 v. Chr." datiert, obwohl dieser Autor und seine Erzählung kaum in den Blick des Lesers kommen, sondern Bilder von der Welt der alten Ägypter, welche noch das bescheidenste Niveau historischen Wissens unterbieten und in ebenso ungelenker wie prätentiöser Sprache formuliert sind. So versteift sich Gasser etwa auf Pronomina der ersten und zweiten Person - wohl um einen Eindruck historischer Unmittelbarkeit hervorzurufen: "Der Tod war nicht Tod, sondern Krankheit und heilbar obendrein. Als Ägypter starben wir nicht - wir kamen davon. Wer nach dem Aussetzen des Herzens, gesalzen, mit Sägemehl gestopft und harzgetränktem Leinen umwickelt, in seiner Pyramidenkammer lag, hatte den höchsten Grad an Lebendigkeit erreicht." Den Verweis im "Quellen-Anhang" auf "grundsätzlich alle Studien Jan Assmanns" müsste der große Ägyptologe als Veruntreuung seines Lebenswerks auffassen, während die weniger anspruchsvolle Mehrzahl von Gassers Referenzen ahnen lässt, dass er seine "Weltgeschichte" vor allem als Chronik kulinarischer Genüsse und sexueller Exzesse konzipiert hat.
Doch wenn diese ersten beiden Kapitel bloß peinlich sind, verletzt Gassers anschließender Text über die "Ilias" eine Schmerzgrenze nicht nur des literarischen Geschmacks. Es beginnt vergleichsweise harmlos mit der politisch korrekten Frage "Weshalb führen Männer Krieg?", die selbstredend im Verweis auf die "Sinnlosigkeit des Krieges" beantwortet wird. Aber dann versucht sich Gasser an einem der ganz großen Momente unserer literarischen Überlieferung, am Bittgang des greisen Priamos zum Zelt der Achilles, der seinen Sohn Hektor im Zweikampf erschlagen und um die Mauern von Troja geschleift hatte. Der Leser ahnt nichts Gutes, sobald er in Gassers Text auf das Adverb "trauerkrumm" stößt, mit dem er die Haltung des um den Leichnam seines Sohnes bittenden Priamos beschreiben will. Aber dann stolpert Gasser nach dem obligatorischen Detail aus der Kulturgeschichte des Essens über ein historisches Missverständnis derart heftig, dass Geschmacklosigkeit zur Pietätlosigkeit wird: "Erst als sein Vater nachts trauerkrumm in Achills Hütte schleicht und kniend um die Leiche Hektors bittet, ist Achill beschwichtigt und teilt mit ihm rosinengefülltes Brot und knusprig gebratenes Schaf. So krochen wir auch Weihnachten 1914 nach Christus unbewaffnet aus unseren Schützengräben und kamen auf dem Niemandsland des Schlachtfeldes über alle Sprachbarrieren hinweg freundschaftlich miteinander ins Gespräch, tauschten unsere Zigaretten und merkwürdige Namen aus, sahen einander dabei in die Augen und suchten vergebens Böses darin."
Priamos, der erniedrigte Vater des geschlagenen Hektor, darf dem Sieger Achill gerade nicht ins Auge blicken, und hätten Trauer und Scham dies je erlaubt, dann wären aus dem Blick nicht einfach "freundschaftliche" Gefühle von allgemeiner Menschlichkeit geworden. Denn anders als für die Soldaten im Ersten Weltkrieg, die zu Weihnachten Urlaub von den Schützengräben nahmen, gab es für die Helden der "Ilias" neben den eigenen Leidenschaften und denen der Götter keine abstrakte Ebene der Existenz. Markus Gasser hätte sich an der homerischen Szene von Priamos und Achill nicht vergreifen dürfen. Dieser Satz mag arrogant klingen, aber er entspringt nicht meiner Anmaßung, sondern dem Impuls, das ästhetische Pathos des Erhabenen und Pathos als vergangenes Leid gegen die Banalisierung grenzenlosen Geredes zu schützen. Hinzu kommt, dass nichts weniger jene Unmittelbarkeit des Vergangenen heraufzubeschwören vermag, um die es Gasser doch geht, als eben das geschäftige Zerreden großer Texte.
In verschiedenen Graden der Intensität oder Peinlichkeit und aus verschiedenen Perspektiven stoßen fast alle Teile von Gassers Buch zu dieser Schmerzgrenze vor. So das Kapitel "Choderlos de Laclos: ,Gefährliche Liebschaften', Paris, 1786 n. Chr.", welches die von politischer Passion getriebenen und sich wohlig in der Pornographie suhlenden Gerüchte der Jakobiner vom ausschweifenden Sexualleben der Königin Marie Antoinette für bare Münze nimmt und Laclos' großen Roman nur am Rande erwähnt. Allenfalls einige Absätze aus dem Kapitel über das Ende des Zweiten Weltkriegs im Erleben des drogensüchtigen Romanciers Hans Fallada haben mich beeindruckt.
Markus Gasser: "Eine Weltgeschichte in 33 Romanen".
Hanser Verlag, München 2015. 301 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur WELT-Rezension
Erschöpft vom Quellen- und Adjektiv-Overkill des Literaturwissenschaftlers Markus Gasser fällt Rezensent Rainer Moritz nach der Lektüre das Buch aus der Hand. Weniger wäre mehr gewesen, seufzt der erschlagene Rezensent. Gasser hat sich 33 historische Romane der Weltliteratur vorgenommen und erzählt in 33 Kapiteln eine kleine Geschichte der Zeit, in der sie spielen. Die Romane selbst, ihre Erzählweise oder auch nur ihr Inhalt ist für den Verfasser unwichtig. Wer die Bücher also nicht gelesen hat, ist hinterher auch nicht wirklich klüger, meint Moritz, der sich immer noch fragt, was Gasser mit diesem "überambitioniert-rätselhaften" Buch eigentlich wollte.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Für sich genommen schon lesenswert, weckt das Buch vor allem Lust auf mehr Literatur." Reutlinger-General-Anzeiger, 23.01.16 "Gassers Portraits von 33 zum Teil wenig bekannten Romanen haben selbst literarische Qualität, und sie zeigen, worin das Faszinierende der von Poeten erzählten Weltgeschichte besteht: Es ist die Sinnlichkeit, mit der hier geliebt und gehasst, gegessen und getrunken, gezeugt und gemordet, gelacht und geweint werden darf!" Manfred Koch, NZZ am Sonntag, 27.09.15