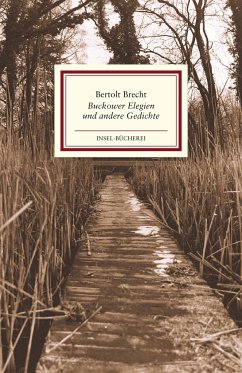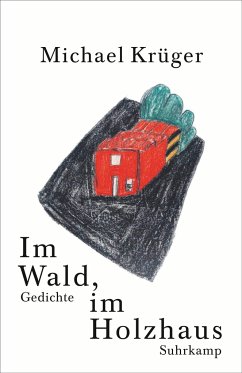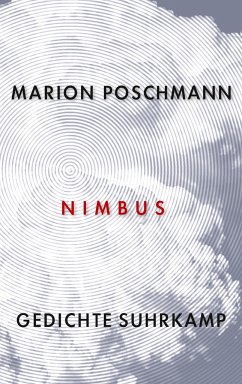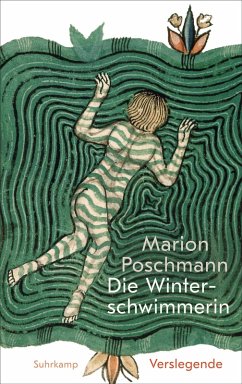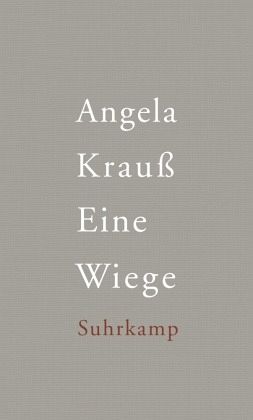
Eine Wiege
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
21,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Es waren kleine Fotografien, aufgenommen von ihrem Vater in den Fünfzigerjahren, die Angela Krauß zu diesem ungewöhnlichen Bekenntnis bewegten. Aus Mutter, Vater, Kind tritt der Mensch in die Welt. Mit der ihr eigenen sublimierenden Kraft erkennt Angela Krauß ihn inmitten seiner Geborgen- und Verlorenheit. Mit diesem Buch wagt sie »die einzig ersehnte Konsequenz des Dichtens: dass meine Person in ihrer poetischen Gestalt restlos auf- also untergeht«.Eine Wiege ist eine Rede in Versen, die uns daran erinnert, wo wir inmitten rasanter Bewegungen zuhause sind.